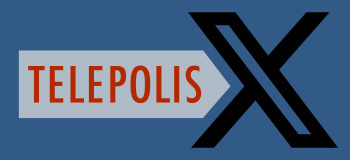KI und Krieg: Nukleare Risiken und politische Forderungen
Seite 2: Notwendige politische Veränderungen
- KI und Krieg: Nukleare Risiken und politische Forderungen
- Notwendige politische Veränderungen
- Auf einer Seite lesen
Eine Politik, die einzig auf eine wechselseitige Konfrontation zwischen dem Westen und Russland oder China setzt, wird zur Folge haben, dass gefährliche Waffensysteme auf allen Seiten mit höchster Priorität weiterentwickelt werden, einschließlich der Einbeziehung von Techniken der KI.
Die aktuellen Kriege bieten ein "ideales Testfeld" zur Erprobung und Perfektionierung dieser militärischen Fähigkeiten. Um eine globale Katastrophe zu vermeiden, die zu einer Vernichtung der Menschheit führen könnte, muss dieser Prozess umgekehrt werden.
Die aktuellen Kriege müssen so schnell wie möglich beendet werden. Statt Waffenlieferungen in Kriegsgebiete sollte umfangreiche Diplomatie das Gebot der Stunde sein. An die Stelle eines gegenseitigen Konfrontationskurses müssen Vertrauen, Kooperationen und gute Kommunikationskanäle wieder aufgebaut und verbessert werden.
Hierbei müssen ökonomische und geostrategische Interessen der verschiedenen Seiten in Verhandlungsprozessen berücksichtigt werden.
Statt neue Hyperschallraketen in Ost und West zu stationieren, sind wirksame Vereinbarungen zur Rüstungskontrolle, einschließlich nuklearer Abrüstung erforderlich. Auch weltweite Vereinbarungen zum Verbot autonomer Waffensysteme und einer Regulierung der KI werden dringend benötigt.
Die Abhängigkeit von Internetdiensten sollte nicht weiter steigen. Stattdessen müssen wichtige Infrastruktursysteme, wie das Gesundheitswesen und die Stromversorgung auch ohne Internet fehlerfrei funktionieren. Auch muss sichergestellt werden, dass gefährliche Waffensysteme, wie Atomraketen, nicht über das Internet ansteuerbar sind.
Hier soll zudem die Auffassung vertreten werden, dass derartige international anzulegende Kontrollprozesse über eine Reform der UN unterstützt werden können – Reformprozesse, die sowohl ihre Struktur als auch den Rechtsstatus der über die UN vertretenen Menschen betreffen.
Die UN sind zum einen in ihrer Wirkmächtigkeit und finanziellen Unabhängigkeit zu stärken, damit sie auch die Macht bekommen, über die notwendigen Zukunftsentscheidungen maßgeblich zu bestimmen.
Gleichzeitig – und immer etwas vor der Erweiterung der Befugnisse – sind die Vereinten Nationen zu demokratisieren, um demokratische Wahlen der UN-Gremien zu gewährleisten und eine legitime und institutionell ausbalancierte Kontrolle über die Entscheidungsgremien zu bekommen.
Die Vision eines Weltbürgerrechts
Immanuel Kant verband seine Idee vom Frieden zudem mit einer Veränderung bzw. notwendigen Ergänzung im Staats- und Völkerrecht:
Da es nun mit der unter den Völkern der Erde einmal durchgängig überhand genommenen (engeren oder weiteren) Gemeinschaft so weit gekommen ist, dass die Rechtsverletzung an einem Platz der Erde an allen gefühlt wird:
So ist die Idee eines Weltbürgerrechts keine phantastische und überspannte Vorstellungsart des Rechts, sondern eine notwendige Ergänzung des ungeschriebenen Kodex, sowohl des Staats- als Völkerrechts zum öffentlichen Menschenrechte (…) überhaupt, und so zum ewigen Frieden, zu dem man sich in der kontinuierlichen Annäherung zu befinden nur unter dieser Bedingung schmeicheln darf.
Gegenwärtige Initiativen zur UN-Reform und zum Weltbürgerrecht müssten auch die Forderungen hinsichtlich der internationalen Kontrolle der KI in ihre Agenda aufnehmen. Dies wird dann die Chancen, die in der gesellschaftlichen Anwendung vorhanden sind, aber auch die Probleme klären müssen, die sich aus einer ungenügend kontrollierten KI-Entwicklung, insbesondere im Zusammenhang mit inter- und intragesellschaftlichen Großkonflikten, ergeben.
Es ist zu erwarten, dass es bei mächtigen Akteuren, die in den Vereinten Nationen ihre Interessen ohne Verantwortung für das Ganze vertreten wollen, erhebliche Widerstände gegen eine UN-koordinierte Kontrolle der KI-Entwicklung geben wird. Doch hier geht es um zu viel, ohne zumindest den Einsatz dafür deutlich zu erhöhen, eine verantwortliche KI-Entwicklung für die weltbürgerliche Gemeinschaft zu erreichen.
Die Autoren:
Prof. Dr. Karl Hans Bläsius, Informatiker mit Schwerpunkt KI
Prof. Dr. Klaus Moegling, Politikwissenschaftler und Soziologe