War's das mit den Kryptowährungen?
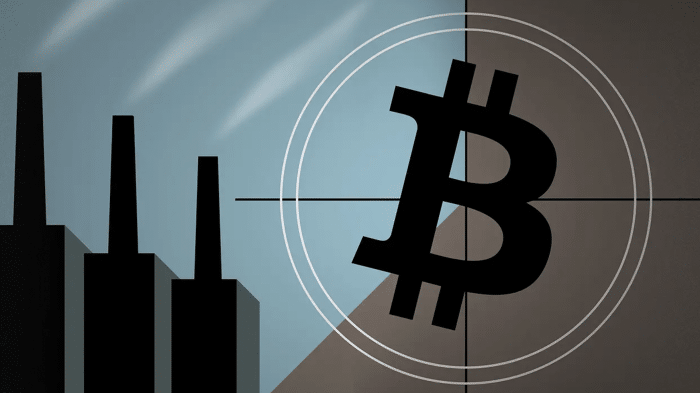
Gedanken über Nutzen und Zukunft von Bitcoin & Co als Geldanlage
Inflation, Inflation, Inflation! Das Wort ist seit Wochen in aller Munde und viele sorgen sich über den Anstieg der Rohstoff- und Energiepreise, der Lebenshaltungskosten und Konsumausgaben. Zurzeit gibt es in verschiedenen Branchen Lieferengpässe, die mit den Lockdowns zu tun haben. Dazu kommen Ersparnisse und aufgestaute Konsumwünsche. Nicht zuletzt haben die Notenbanken in den letzten Jahren Geld in Billionenhöhe geschöpft, um diverse Krisen abzufedern. Das könnte vermehrt in die Märkte strömen und die Preise weiter in die Höhe treiben.
Gegen die wundersame Geldvermehrung unseres heutigen Fiatgeldsystems - in dem Geld im Wesentlichen durch Kreditvergabe erzeugt wird - hat der sagenumwobene Informatiker mit dem Pseudonym Satoshi Nakamoto Ende der Nullerjahre eine neue Währung entwickelt: den Bitcoin. Hier stand von Anfang an fest, dass es nie mehr als rund 21 Millionen Einheiten geben würde, die sich allerdings in kleinere Einheiten unterteilen lassen. Nun überrascht, dass Bitcoin, die größte aller Kryptowährungen, trotz des Inflationsrisikos in den letzten Wochen stark an Wert verloren hat. Wie lässt sich das erklären?
Bitcoin-Grundlagen
Zuerst ein paar Grundlagen: Um Bitcoin (BTC) zu erzeugen, müssen kryptografische Rätsel gelöst werden. Wer durch Herumprobieren die Lösung findet, bekommt zur Belohnung eine bestimmte Anzahl gutgeschrieben. Zurzeit sind es 6,25 BTC. Diese Belohnung halbiert sich nach jeweils 210.000 gefundenen Lösungen, wodurch sich die genannte Obergrenze ergibt. Dabei wird die Schwierigkeit der Aufgabe so gewählt, dass in etwa alle zehn Minuten eine Lösung gefunden wird. Von den maximal verfügbaren 21 Millionen wurden bisher bereits 18,7 Millionen geschöpft, also knapp 90 Prozent.
Wenn man diese Zahl mit dem derzeitigen Wert (Stand 23. Mai 2021) von rund 28.000 Euro pro Bitcoin multipliziert, kommt man auf die sogenannte Marktkapitalisierung von rund 524 Milliarden Euro. Ich komme später noch einmal darauf zurück, was uns diese Zahl aussagt. Innerhalb der letzten 24 Stunden wurden rund 900 neue BTC geschöpft und (laut Coindesk.com) BTC im Wert von knapp zehn Milliarden US-Dollar gehandelt.
Um Handel zu ermöglichen, verwenden die Teilnehmer private und öffentliche kryptografische Schlüssel. Mit dem privaten (und geheimen) Schlüssel weist man sich als Besitzer der Kryptowährung aus. Die gewünschte Transaktion verbreitet man über das Peer-to-Peer-Netzwerk, auf dem der Bitcoin läuft. Wenn jemand das nächste Rätsel löst, erzeugt er mit der Lösung einen neuen Block, in den ein Teil der offenen Transaktionen gespeichert und damit besiegelt wird.
Da es mehr Transaktionswünsche als Platz in so einem Speicherblock gibt, bieten die Teilnehmer eine Transaktionsgebühr von zurzeit im Schnitt 13 Euro. Je höher die Gebühr, desto schneller wird die Transaktion aufgenommen. Durch das Aneinanderreihen der Blöcke entsteht die sogenannte Blockchain, eine Blockkette, die die Historie aller Transaktionen umfasst. Wer das Rätsel gefunden hat, bekommt dann nicht nur die genannte BTC-Belohnung, sondern auch die gebotenen Gebühren für die gehandelten Bitcoins. Damit finanzieren die sogenannten Miner ("Schürfer") ihre Kosten und behalten den Rest als Gewinn.
Die Erfolgsstory des Bitcoins ging damit einher, dass immer mehr Nutzer auf den Zug aufsprangen. Während man früher noch auf dem heimischen PC neue BTC schürfen konnte, gelingt das heute im Grunde nur noch großen Serverfarmen mit spezialisierter Hardware. Da die Rentabilität von den Energiekosten abhängt, stehen viele dieser Farmen heute in China, wo der die Energiekosten vergleichsweise niedrig sind.
Dabei hat die zentralistische Regierung Chinas seit 2013 in mehreren Schritten den Handel mit BTC verboten, lässt das Schürfen aber weiter zu. Darin äußert sich ein zwiespältiger Umgang mit der Kryptowährung: Einerseits will man Finanzströme kontrollieren, was das dezentrale und pseudonymisierte BTC-Netzwerk erschwert, andererseits aber ein großes Stück vom Kuchen. Die zunehmende Regulierung ging übrigens jeweils mit (kurzfristigen) Wertverlusten der Währung einher.
Was ist ein Bitcoin wert?
Denken wir erst einmal darüber nach, wie Dinge ihren Wert bekommen. Dabei unterscheidet man den intrinsischen (inneren) vom extrinsischen (äußeren) Wert. Ersterer ergibt sich daraus, was man mit dem Ding selbst machen kann. Ein Stück Käse kann man beispielsweise essen oder für eine Mausefalle verwenden. Letzterer wird dadurch bestimmt, was jemand dafür zu bezahlen bereit ist. In meinem Supermarkt um die Ecke wären das beispielsweise 1,89 Euro für 125 Gramm Camembert.
Nehmen wir im Vergleich dazu eine Silbermünze, etwa eine in Österreich geprägte Wiener Philharmoniker. Diese besteht aus einer Feinunze (31,3g) reinem Silber. Deren intrinsischer Wert ergibt sich daraus, was man damit machen kann: Beispielsweise den Anblick genießen, sie als Briefbeschwerer verwenden oder einschmelzen und als Industriemetall für die Produktion anderer Güter einsetzen.
Die Münze hat nun interessanterweise zwei extrinsische Werte: Der Erste ist der nominale Wert von 1,50 Euro, den die Münze Österreich AG ihr als Teil der Europäischen Währungsunion gibt; der andere ist der Tauschwert, den die Münze am Markt hat, und das sind zurzeit rund 28 Euro. Und dieser Wert ergibt sich schlicht daraus, was jemand für diese Menge an Silber zu zahlen bereit ist. Da der Tauschwert viel höher ist als der nominale Wert, verwendet niemand, der ganz bei Sinnen ist, diese Münze als Zahlungsmittel. Es gibt auch Münzen ohne Nominalwert, etwa die traditionelle Krugerrand-Goldmünze.
Was ist nun der Wert eines Bitcoins? Ein innerer Wert lässt sich hier meiner Meinung nach gar nicht bestimmen, da es sich schlicht um Zahlenfolgen in der Blockchain handelt, die sich zudem beliebig kopieren lassen. Nur durch den privaten Schlüssel weist man sich als Besitzer der Kryptowährung aus. Der intrinsische Wert dieses Schlüssels ist also, über eine bestimmte Menge an Bitcoin in der Blockchain verfügen zu können.
Wertentwicklung des Bitcoins
Der äußere Wert des Bitcoins ist schlicht der Wert, den jemand zurzeit am Markt dafür zu bezahlen bereit ist, eben die rund 28.000 Euro pro BTC, vergleichbar den 28 Euro pro Philharmoniker-Silbermünze. Bekanntermaßen bekam man einen Bitcoin vor vielen Jahren für ein paar Cent. Mitte 2016, wie man auf dem folgenden Chart sieht, musste man dafür schon mehrere hundert Euro bezahlen.
Man sieht, dass es im Dezember 2017 eine erste Kursexplosion gab: Der Wert eines BTC stieg damals auf fast 17.000 Euro. Danach fiel er wieder bis zum Jahreswechsel 2018/2019 auf knapp 2.800 Euro. Bis zum Juni 2019 gab es einen erneuerten Anstieg bis auf knapp über 12.000 Euro. Der Kurs fiel dann wieder auf rund 5.800 Euro zurück (Dezember 2019). Wie bei vielen anderen Werten gab es dann einen Crash im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie im März 2020.
Seit Erreichung des bisherigen Allzeithochs im April gab es aber den eingangs erwähnten Kursabfall auf zurzeit rund 28.000 Euro (und während ich diesen Artikel schrieb übrigens zeitweise auf bis zu 25.500 Euro). Wer also im April zu €54.000 BTC gekauft hat und immer noch hält, hat im Moment fast die Hälfte seiner Investition verloren. Im Detail:
Folgenreiche Tweets
Resümieren wir einmal, was dem Bitcoin in den letzten Monaten Aufwind gab - und was ihn wieder an Wert verlieren ließ. Im August 2020 investierte die US-Firma MicroStrategy 250 Millionen US-Dollar in die Kryptowährung. Firmenchef Michael J. Saylor rührt seitdem aktiv die Werbetrommel für BTC und gibt mitunter sogar deutschen Youtubern Interviews. Er behauptet, ab einer Marktkapitalisierung von 100 Milliarden US-Dollar sei eine Kryptowährung praktisch nicht mehr zu verdrängen und auf lange Sicht würden sie Gold als Vermögensschutz entwerten. Neben Bitcoin hat zurzeit nur die Kryptowährung Ether so einen hohen Marktwert (ca. 189 Milliarden Euro).
Im Oktober investierte auch die US-Firma Square Inc. einen Teil ihres Vermögens in Bitcoin. Im November folgte dann die Ankündigung vom Internet-Bezahlungsdienstleister PayPal, dass US-Kunden über den Dienst BTC handeln und halten können. Ende jenes Monats erreichte die Kryptowährung dann ein neues Allzeithoch. Im Januar 2021 twitterte Elon Musk, einer der Mitgründer von PayPal, über Bitcoin. Das trieb den Kurs innerhalb einer Stunde um 5.000 US-Dollar in die Höhe.
Kurz darauf folgte eine weitere positive Meldung von MicroStrategy, man halte nun schon über zwei Milliarden US-Dollar in der Kryptowährung. Am 8. Februar machte Musks Elektroauto-Unternehmen Tesla dann bekannt, 1,5 Milliarden US-Dollar in BTC investiert zu haben. Zudem könne man die Autos bald mit der digitalen Münze bezahlen. Es folgte ein neues Allzeithoch am 21. Februar und dann, nach einem Kursrücksetzer eine Woche später, die vorher erwähnten rund 54.000 Euro am 14. April, die das bisherige Allzeithoch markieren.
Obwohl, wie eingangs erwähnt, Inflation in aller Munde ist, fiel der Bitcoin seitdem in zwei Wellen: erst auf unter 39.000 Euro am 25. April und dann auf unter 28.000 Euro bis heute. Das Handelsvolumen ist in der laufenden Woche das höchste seit dem Corona-Crash im März 2020; und der Kurs erreichte seinen Tiefstwert seit Januar 2021.
In dieser Zeit gab es neue Diskussionen über eine Regulierung des Bitcoins und machte Elon Musk für Tesla einen Rückzug, da die Umweltbilanz der Kryptowährung doch sehr schlecht sei. Multimilliardär Musk gab sich inzwischen selbst den Titel "Technoking von Tesla" und setzte mit mehreren Tweets auch den Kurs des Dogecoin in Bewegung.
Schlussbetrachtungen
Ziehen wir ein Fazit: Die starken Kursschwankungen stellen die Funktion des Bitcoins als Wertspeicher und Inflationsschutz infrage. Zwar locken große Gewinne - das Risiko großer Verluste ist aber auch nicht unerheblich. Dass die Tweets US-amerikanischer Techno-Milliardäre den Kurs so stark beeinflussen, spricht ebenfalls nicht für dessen Stabilität.
Man könnte auch einmal darüber nachdenken, inwiefern hier eine Marktmanipulation vorliegt. Etwa in dem Sinne: Man kauft privat oder mit seiner Firma das Gut. Dann äußert man sich öffentlich positiv darüber. Dann laufen einem viele hinterher und kaufen. In die dann steigenden Kurse verkauft man vielleicht wieder mit Gewinn?
Als alternatives Zahlungsmittel kommt der Bitcoin sowieso nicht infrage: Hierfür sind die Transaktionsgebühren viel zu hoch und dauert die Erzeugung neuer Blöcke viel zu lange. Zwar gibt es dafür Lösungsvorschläge, wie etwa das auf BTC aufsetzende Lightning-Netzwerk, die aber wieder neue Probleme mit sich bringen. Kosten, Nutzen und Sicherheit muss man dabei immer mit bestehenden Zahlungsmöglichkeiten vergleichen, beispielsweise Banküberweisungen, Kartenzahlungen und Banking-Apps.
In Ländern mit instabiler Währung - etwa in Südamerika oder der Türkei - ist der Aspekt der Werterhaltung von größerer Bedeutung. Anstatt mit der heimischen Währung seine Ersparnisse zu verlieren, könnte man diese in Kryptowährungen tauschen. Dann wäre aber beispielsweise Tether (USDT) eine bessere Alternative, da diese verspricht, Investitionen eins zu eins in US-Dollar umzusetzen. Es handelt sich also um eine Art privaten digitalen US-Dollar. Dadurch kommt aber eine Zwischenebene dazu, die spätestens dann hinfällig würde, wenn die USA selbst einen digitalen US-Dollar anbieten.
Magere Bilanz
Was bleibt? Auch wenn die Schätzungen auseinanderlaufen, muss man den Bitcoin und ähnlich rechenintensive Kryptowährungen wohl als Umweltsünder bezeichnen. Wie viel Strom die Serverfarmen genau verbrauchen, hängt nicht zuletzt von der verwendeten Hardware ab und wird nicht zentral erfasst.
An manchen Orten mag man die nächste Lösung für das kryptografische Rätsel mit Öko-Strom suchen, den man gerade anders nicht verwenden kann. Insgesamt gilt hier aber das Marktprinzip: Wo der Strom am billigsten ist, rentiert sich der Betrieb am meisten. Und das schließt auch Kohlekraftwerke ein, die massenweise Kohlendioxid ausstoßen.
Ich schließe nicht aus, dass sich der Kurs des Bitcoins wieder vervielfacht. Aber ich denke, dass man es als reine Spekulation betrachten muss. Haus und Hof sollte man daher keinesfalls verwetten. Dabei haben wir noch gar nicht von Krisenszenarien gesprochen: Zwar gibt es – neben der Kryptographie – Sicherungsmechanismen, die mit der Größe des Peer-to-Peer-Netzwerks zu tun haben. Wie alle Computernetzwerke ist aber auch die Blockchain angreifbar.
Falls beispielsweise die Konflikte zwischen Großmächten wie China, Russland oder den USA weiter eskalieren, kann man nicht ausschließen, dass Geheimdienste mit immensen Rechenkapazitäten eine Kryptowährung kapern – 51-Prozent Angriff – oder zumindest lahmlegen, um nationale Interessen zu verfolgen. Wenn es in so einem Fall zu einem Abverkauf kommt - wie beispielsweise im März 2020 -, dann haben die Kleinanleger das Nachsehen: Denn wer die höchsten Transaktionsgebühren bietet, der schafft es am schnellsten in die Blockchain. Es gilt das Marktprinzip von Angebot und Nachfrage.
Daher kann ich das demokratische Image, das dem Bitcoin anhaftet, nicht nachvollziehen. Das Schürfen ist für Kleinanwender schon lange nicht mehr rentabel. Das verteilte Netzwerk bietet zwar eine gewisse Stabilität - aber im Endeffekt hat die Gruppe mit der größten Rechenkapazität das letzte Wort. Falls sich verschiedene Gruppen zu einer großen Räuberbande zusammenschließen, kann man als einzelner Nutzer wenig dagegen tun.
Alternativen
Alternativen zum Bitcoin wie Ethereum bieten andere Innovationen, etwa sogenannte Smart Contracts oder Non-fungible Tokens (NFT). Damit lassen sich beispielsweise digitale Kunstwerke oder Gegenstände von Computerspielen fälschungssicher handeln. Solche Innovationen kann man aber mit einer Vielzahl von Systemen realisieren - und es gibt schon mehrere tausend Kryptowährungen. Ob sich der persönliche Favorit durchsetzt, gleicht einem Glücksspiel.
Über alldem hängt das Damoklesschwert der staatlichen Regulierung: Die weitreichende Anonymität und der Zahlungsverkehr rund um den Globus ziehen natürlich auch Kriminelle an. Nicht ohne Grund werden Lösegelder beispielsweise für gehackte Computersysteme gerne in Kryptowährungen eingefordert. Daher ist der Druck groß, bei Brokern und Börsen, wo man Bitcoin und Co in echtes Geld oder andere Güter tauschen kann, die Identifizierungsmaßnahmen zu verstärken.
Zwar gibt es inzwischen schon finanzstarke Lobbygruppen, die hinter den Kryptowährungen stehen. Aber man dürfte auch auf staatlicher Seite Belege dafür sammeln, dass die Kryptowährungen zur Geldwäsche, zur Finanzierung von Kinderpornographie und Terrorismus verwendet werden, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Sobald es stärker regulierte und kontrollierte Systeme gibt, könnte man damit Einschränkungen bei den privaten Kryptowährungen rechtfertigen. Dabei dürfte allein schon die Ankündigung solcher Maßnahmen zu Kursverlusten führen.
Somit bleibt für mich der Eindruck, dass es sich doch nur um ein großes Schneeballsystem handelt: Profitabel ist es vor allem für diejenigen, die früh dabei waren, die die Infrastruktur bereitstellen und die am schlausten investieren. Eine Investition in BTC macht meiner Meinung nach nur dann Sinn, wenn man davon ausgeht, dass jemand dafür später mehr Geld bezahlt. Ob das sinnvoller ist, als beim Roulette auf Rot oder Schwarz zu wetten, muss jeder für sich entscheiden.
Dabei sollte man die Vorteile des bestehenden Zahlungssystems nicht ganz vergessen: Auch wenn viele Banken seit der Finanzkrise einen Imageverlust erlitten haben, garantieren sie nach wie vor sichere Überweisungen und Verwahrung von Geld. Die Flutung der Märkte mit Liquidität geschah nicht nur zum Spaß, sondern zur Stützung der Wirtschaft und Volkswirtschaften. Bisher jedenfalls hat sich eine Katastrophe wie in den 1930er-Jahren noch nicht wiederholt. Damals war man noch an den Goldstandard gebunden und konnte man Geld nicht so einfach durch Kreditvergabe erzeugen.
Persönliche Schlussbemerkung
Während ich diesen Artikel schrieb, verfolgte ich mit einem Auge die Kurse von Bitcoin und Ethereum. Ich hatte am 19. Mai mit kleinen Kursverlusten alle Kryptowährungen verkauft und wollte mit dem Wiedereinstieg auf ein positiveres Marktumfeld warten. Ein Bekannter, der damit sehr viel Geld verdient hat, meinte dann aber zu mir, jetzt müsse man wieder einsteigen: "Geh all in." Zu dem Zeitpunkt hatte er selbst schon einen sechsstelligen Buchverlust.
Also investierte ich einen kleinen vierstelligen Betrag und definierte ich einen Maximalverlust von 25 Prozent. Für Ethereum wurde dieser ausgelöst, während ich den Artikel schrieb; bei BTC ist das Rennen noch offen. Die Kryptowährungen kennen zurzeit aber vor allem eine Richtung: nach unten. Daher sollte man nur Beträge investieren, die man nicht dringend braucht. Da ich vorher Gewinne mitgenommen habe, macht mir dieser Verlust wenig aus. Er hätte aber auch nicht sein müssen.
Am Anfang des Textes war ein Bitcoin noch 29.000 Euro wert. Bei 28.000 Euro habe ich die Zahlen im Artikel angepasst. Jetzt nähert sich der Kurs schon den 26.000 Euro und lasse ich alles so stehen. Daher sollte man auch die Rede von der Marktkapitalisierung nicht zu wörtlich nehmen:
Noch am 14. April lag diese bei über einer Billion Euro. Jetzt hat sie sich halbiert. Was ist mit dem Wert passiert? Er hängt eben ausschließlich davon ab, was der Nächste dafür zu zahlen bereit ist. Und wenn jemand für einen gefüllten Staubsaugerbeutel 10.000 Euro bezahlen will, warum auch nicht!
Dieser Artikel erscheint ebenfalls im Blog "Menschen-Bilder" des Autors.