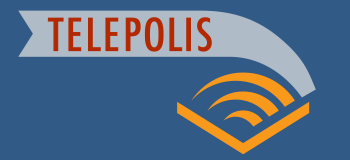Bauernproteste erschüttern Paris: Frankreichs Landwirte am Limit
Seite 3: Andere Polarisierungen: Unterschiede zu Deutschland
- Bauernproteste erschüttern Paris: Frankreichs Landwirte am Limit
- Kampf gegen Dumpingpreise: Landwirte vs. Supermarktketten
- Andere Polarisierungen: Unterschiede zu Deutschland
- Auf einer Seite lesen
Während der rechtere Teil der protestierenden Bauern in Deutschland vorrangig rabiat auf die Grünen losgeht, existiert in Frankreich eine Polarisierung zwischen unterschiedlich ausgerichteten Agrarorganisationen.
Sie streiten unter Umständen auch vor Gericht gegeneinander, wenn es um den Einsatz der Confédération paysanne für ökologische Ziele geht.
Zu den ersten Zugeständnissen, die die französische Regierung am 1. Februar ankündigte, zählte zunächst der Verzicht auf die – wie in Deutschland – zuvor geplante Aufhebung der Steuerbefreiung auf Agrardiesel, französisch GNR abgekürzt.
Aber auch die Aussetzung des Plans Ecophyte, der in den kommenden Jahren zu einer Reduzierung des Pestizideinsatzes hätte führen sollen; unmittelbare Konsequenz dürfte sein, dass viele Landwirte selbst in naher Zukunft einem erhöhten Krebsrisiko ausgesetzt werden.
"Man hat ihnen (den Protestierenden) eine Droge zur Beruhigung verschrieben", kritisierten Umweltverbände. Die in den letzten Jahren erfolgte Reduzierung des Pestizid-Einsatzes hatte dazu geführt, dass etwa das um Jahr 2000 beobachteten Bienensterben zurückging: Intensiv-Landwirte, die künftig aufgrund der Auswirkungen auf Insekten ein Bestäubungsproblem für ihre Pflanzen bekommen, dürften sich dann noch wundern.
"Genauso arm, aber mit Pestiziden"
„Die Bauern sind immer noch genauso arm, aber mit Pestiziden“, kommentierte die Aufschrift eines Aufklebers dazu sarkastisch. Dank dieses Kompromisses auf dem Rücken durchaus vernünftiger ökologischer Zielsetzungen konnte die Regierung jedoch zunächst die beiden rechteren Bauernverbände vergleichsweise stillhalten – während die Confédération paysanne ihre Aktionen gegen die Preispolitik von Handelsketten den ganzen Februar hindurch fortsetzte.
Am ersten Tag der Landwirtschaftsmesse (24. Februar) setzte Staatspräsident Macron, wohl im Wissen darum, dass die Pestizid-Droge auf Dauer nicht reichen würde, die Ankündigung eines neuen Zugeständnisses drauf.
Er kündigte, zunächst in sehr allgemein gehaltener Form, die Ausarbeitung von "Mindestabnahmepreisen" (oder prix planchers) an. Dies löste breite und intensive Diskussionen aus. Viele Beteiligte halten das Prinzip für sinnvoll, stellen aber fest, dass es sehr auf die Details ankomme.
Mindestabnahmepreis: Wie soll er das Problem lösen?
Erzeugerpreise für Kuh- oder Ziegenmilch sind etwa im Flachland und in Bergregionen, oder auch abhängig von der Betriebsgröße keineswegs identisch. Soll jedoch ein Mindestabnahmepreis regional gelten, oder national?
Oder aber auf EU-Ebene, dann aber – so wird befürchtet – so niedrig, dass er kein Problem löst? Die Frage ist auch, wie Importe behandelt werden, und ob diesen eventuell neue Marktsegmente eröffnet werden, liegt ein französischer Mindestabnahmepreis vergleichsweise hoch.
Zahlreiche Widersprüche
Diese Debatten stehen erst am Anfang. Und sie decken zahlreiche Widersprüche auf. So ist der derzeitige Wirtschaftsminister Bruno Le Maire nun damit beauftragt, Macrons Vorschlag vom Mindestabnahmepreis als Lösung, gerne auch als Allheilmittel zu verkaufen.
Nur wiesen etwa die Milcherzeuger zu Wochenanfang darauf hin, es sei derselbe Le Maire – er war 2008/09 Nicolas Sarkozys Minister für Europaangelegenheiten, danach drei Jahre lang dessen Landwirtschaftsminister – gewesen, der 2009 Mindestabnahmepreis zerschlug, die damals de facto infolge von Absprachen zwischen Erzeugern und Handel praktiziert wurden: Diese seien EU- und wettbewerbswidrig.
Kritik von Le Pen
Aber auch weiter rechts sorgt die Idee für Widersprüche und, rasch unter den Teppich gekehrte, Kontroversen. Jordan Bardella, rechtsextremer Spitzenkandidat zur Europaparlamentswahl, attackierte Macrons Vorschlag am Wochenende zuerst.
Seine Parteifreundin Marine Le Pen musste ihn daran erinnern, dass ihre Partei, der Rassemblement national, diese Forderung aber seit zehn Jahren im Programm stehen hatte. Prompt musste Bardella zurückrudern und das Gegenteil seiner Äußerungen vom Sonntag behaupten. Was zu Verwirrung in seiner Partei führte.
Widersprüche tauchen dort auch zum Thema Freihandel oder Protektionismus auf: Noch vor kurzem stimmten RN-Abgeordnete für die Eröffnung von Freihandelsverhandlungen etwa mit Neuseeland, mit dem Ansinnen verbunden, Frankreichs Agrarwirtschaft möge auf Teufel-komm-raus exportieren.
Jetzt verlegt die extreme Rechte sich auf protektionistische Anklagen gegen den Widersinn, man plane, Hammelfleisch aus Neuseeland über 18.000 Kilometer nach Frankreich zu importieren – was tatsächlich ökologisch irrsinnig ist –, was vor ein oder zwei Jahren nicht im Vordergrund für sie stand.
Das dürfte den RN nicht daran hindern, viele Proteststimmen bei der EU-Wahl einzustreichen.