Benötigen wir nur mehr Wohnungen oder auch andere Formen des Wohnens?
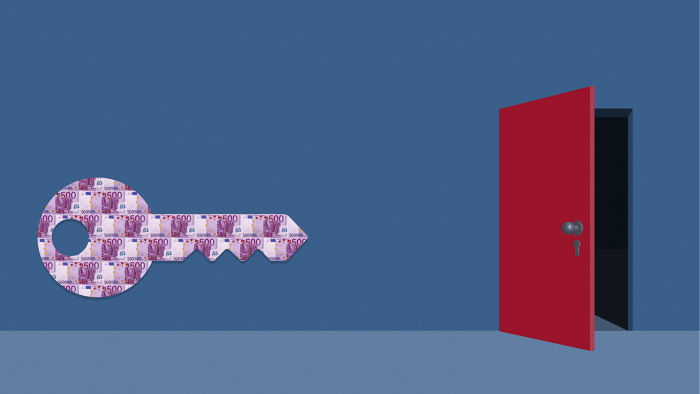
Der Wohnungsbau befindet sich in der Klemme. Unklar ist, was er künftig schaffen soll: sichere Geldanlagen, ein erschwingliches Zuhause oder den Stoff zur Gemeinschaftsbildung.
Folgt man Robert Musils epochalem Roman Mann ohne Eigenschaften, dann stellt der Wohnungsbau die neutralisierende Hülle für die "kochende Blase" der Intimität dar. In der heutigen Konsumgesellschaft freilich gart sie nur noch lauwarm vor sich hin. Denn man kann ja kaum behaupten, dass wir über ein Habitat verfügen, das allen Ansprüchen genügt und sich problemlos an verändernde Lebenssituationen anzupassen vermag.
Im Gegenteil: Man muss konstatieren, dass sich aktuell um den Wohnungsbau in Deutschland ein ganzes Problemkonvolut rankt. Weshalb sich selbst Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unlängst veranlasst sah, zu betonen, dass "ideologische Grabenkämpfe keine neuen Wohnungen schaffen. Sondern wir brauchen beherzte Kommunen, Investoren, Bauherren und Stadtplaner, die sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst sind. Und die Spielräume wirklich nutzen, die es heute schon gibt."
Wie die jüngere Vergangenheit lehrt, haben sich Aufschwung- und Rezessionsphasen (mit besonders niedriger Bautätigkeit) abgewechselt. Der aktuelle Boom hat mit der anhaltend hohen Nachfrage nach Wohnraum zu tun. Diese ist auch auf die positive wirtschaftliche Entwicklung mit hohen Beschäftigtenzahlen, niedriger Erwerbslosigkeit und steigenden Löhnen zurückzuführen.
Freilich kann man auch aus einer anderen Warte auf diese Prozesse schauen: In den vergangenen fünfzig Jahren sind weltweit die Bedingungen für den Zugang zu Wohnraum zunehmend auf den Markt verlagert worden. In der Nachkriegszeit griffen viele Wohlfahrtsstaaten unter der Ägide des sozialen Wohnungsbaus gewissermaßen die industrielle Revolution wieder auf, um sicherzustellen, dass den Bürgern angemessene und faire Wohnungen zur Verfügung gestellt wurden.
In diesen drei oder vier Jahrzehnten wurde der Wohnungsbau zur Verantwortung des Staates und damit nicht nur mit wirtschaftlicher Rechenschaftspflicht, sondern auch mit demokratischen Versprechen ausgestattet.
Doch ab Ende der 1970er-Jahre arbeiteten die neu gewählten neoliberalen Regierungen daran, die Institutionen des sozialen Wohnungsbaus abzubauen und an ihrer Stelle neue zu errichten.
Das Recht auf Wohnung ging vom Belegungsrecht – einem Konzept, das sich auf das Grundbedürfnis nach Unterkunft bezieht – zum Recht auf Eigentum über. Mit immensen wirtschaftlichen Folgen: Der globale Immobilienmarkt repräsentiert den Vereinten Nationen zufolge nahezu 60 Prozent aller Vermögenswerte, wovon wiederum 75 Prozent auf Wohnimmobilien entfallen. Das entspricht mehr als dem doppelten des weltweiten Bruttosozialprodukts.
Aber natürlich auch mit allerlei gesellschaftlichen Konsequenzen. Dass aktuell der Wohnungsbau wieder im Fokus steht, hat leicht nachvollziehbare Gründe. Aufgrund des sich durch verbreitet steigende Mieten und Kaufpreise erkennbaren Wohnungsmangels besteht weitgehend Einigkeit, dass nur ein erhöhtes Wohnungsangebot den Nachfrageüberhang und damit die Preisdynamik abbauen kann. Volkswirtschaftlich betrachtet strebt der ideale Markt zu einem Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage.
Aufgrund der Unvollkommenheit des Wohnungsmarktes und der Wohnimmobilien (immobil, nicht substituierbar, wenig fungibel etc.) ist ein Gleichgewichtszustand weder ein automatisch eintreffender Zustand noch über genau definierte Preis-Mengen-Verhältnisse beschreibbar.
Um das Mengenproblem zu lösen, wird in der Regel auf den Wohnungsbedarf abgestellt. Mittels demografischer Prognosen wird berechnet, welcher Wohnungsneubau notwendig ist, um kurz- bis langfristig der Nachfrageentwicklung angemessen zu begegnen.
Der Wohnungsneubau ist jedoch nicht nur ein Reflex auf die steigende Nachfrage nach Wohnraum, sondern auch ein Abbild der modernen Wohnwünsche und Präferenzen der Haushalte sowie der technischen Weiterentwicklungen. Schließlich stellen stark veränderte Rahmenbedingungen den Wohnungsbau vor große Herausforderungen.
Die Zyklen des Wohnungsbaus gingen bis vor zehn Jahren, wenn auch phasenversetzt, mit den Zyklen des Finanzmarktes – mit steigenden und fallenden Zinsen – einher. Seit es die gefühlt "ewige" Niedrigzinsphase gibt, löst sich dieser Zusammenhang auf und es bleibt offen, ob sich die Konjunktur angesichts des billigen Geldes und der hohen Attraktivität der Immobilien als Geldanlage wieder in normalen Bahnen bewegen wird.
Unterschiedliche regionale Wohnungsmarktsituationen sorgen zudem für eine neue Unübersichtlichkeit. Das dramatische und zunehmende Nebeneinander von dynamischen Wirtschaftsregionen und peripheren, strukturschwachen Räumen führt zwangsläufig zu der Frage, welche Strategien für die Wohnungsversorgung der Bevölkerung erfolgversprechend erscheinen.
Rein mengenmäßig würden ja die leerstehenden Wohnungen in Deutschland ausreichen, alle Wohnungsmarktengpässe zu beheben. Sie sind jedoch "immobil" und können nicht dorthin transferiert werden, wo sie hauptsächlich nachgefragt werden, etwa in den Boomregionen.
In den vergangenen Jahren haben sich zunehmend Hemmnisse des Wohnungsneubaus herauskristallisiert. Gerade aus Investorensicht werden folgende Aspekte als besonders problematisch herausgehoben: Unzureichende Anzahl geeigneter und bezahlbarer Baugrundstücke mit einem preistreibenden Wettbewerb um Bauland; Auslastung der Bauwirtschaft und zunehmender Fachkräftemangel; steigende Baukosten; lange Planungs- und Genehmigungsverfahren; Zunahme und Komplexität an Bauvorschriften; nachbarschaftliche und zivilgesellschaftliche Widerstände, die Baumaßnahmen ausbremsen oder verhindern (Stichwort: "Not in my backyard").
Wohnen neu denken
Sieht man einmal vom Problem der quantitativen Verfügbarkeit von Unterkünften ab, so lautet eine entscheidende Frage: Woher wollen wir wissen, wie man in Zukunft wohnen will? Der an der Hafencity-Universität Hamburg lehrende Architekt Bernhard Kniess wies jüngst darauf hin, dass sich bei diesem Thema Zukunft nicht nur daran zeige, wie die Wohnung unseren gegenwärtig praktizierten Lebensweisen entsprechend angeeignet wird, sondern was sie ermöglicht und begünstigt.
Das habe zur Folge, dass wir uns über die Wohnung selbst Gedanken machen müssen und nicht einfach nur gängige Modelle reproduzieren. Dabei gelte es auch, die demografische Entwicklung einer überalternden Gesellschaft mitzudenken. Das heißt nicht nur bestehende Wohnungstypologien mit Haushaltsgrößen quantitativ abzugleichen, sondern auch unsere Praktiken des Wohnens mitzubetrachten.
Aber die zunehmend in Bündnissen zwischen Politik und Wohnungswirtschaft verfolgten Lösungsansätze fokussieren vorrangig bloß quantitative Ziele. Wenn es um die Qualität zukünftigen Wohnens gehe, seien für ihn nicht allein Lage, Größe oder Ausstattung maßgeblich, sondern insbesondere die Frage nach einer neuen Sozialität im Wohnen – und zwar jenseits der Kernfamilie.
Eine naheliegende Lösung sieht Kniess etwa in der Gestaltung eines reduzierten persönlichen Rückzugbereichs in Verbindung mit gemeinschaftlich geteilten Lebensbereichen und eingebettet in eine erweitert zu denkende städtische Infrastrukturlandschaft. Ein Verständnis von Wohnen also, das sich in die Stadt erweitert und nicht von ihr geschützt (gated) abgrenzt.
Das freilich ist leichter gesagt als getan. Denn die Träger des Wohnungsbaus sind – oder verstehen sich als – Teil eines Milieus, das Wohnen habituell buchstabiert. Sie folgen vermeintlich abgesicherten und tendenziell retroaktiven Vorstellungen von Behausung. Sie sind damit in den wenigsten Fällen die Träger von Innovation.
Und da treffen sie sich, andererseits, mit den Bewohnern und Nutzern: Mag man das bürgerliche Familien- und Wohnmodell auch als ein hegemoniales Kulturkonzept werten, so muss man doch sehen, dass die in diesem Modell implizierten Vorstellungen von Lebensqualität sich de facto bis heute als außerordentlich attraktiv erwiesen haben.
Auch die Produktion der Wohnungen selbst – die Art, wie gebaut wird – ist unbefriedigend. So rasant Gebäudehüllen oder technische Ausrüstung sich auch verändert haben mögen, einen Einfluss auf den Prozess der Herstellung von Wohnbauten übten sie kaum aus. Die Fabrikation von Häusern erfolgt auch heute meist noch altbacken, indem die Konstruktion direkt auf der Baustelle (als Mauerwerk oder in Ortbetonbauweise) erstellt wird.
Neubauten werden für gewöhnlich als Unikate geplant und erzeugt. Vorgefertigte Bauteile kommen in großen Stückzahlen allenfalls vereinzelt zum Einsatz. Selbst Fenster oder Aufzüge werden zumeist individuell für die jeweilige Baumaßnahme in ihren Abmessungen hergestellt.
Und auch beim Innenausbau von Wohnungen sieht es kaum besser aus. Die Folge: Der geringe Grad der Standardisierung erschwert während des gesamten Lebenszyklus spätere Modernisierungsmaßnahmen, da für jedes Projekt wiederum maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln sind. Und das ist teuer, langwierig und kompliziert.
Schon vor 150 Jahren befasste sich Friedrich Engels bekanntlich mit der Wohnungsfrage. Die Erklärungen des Wuppertaler Fabrikantensohns, warum sich das Finanz- mit dem Immobilienkapital für die Wohnungsspekulation verbindet, ist auf die derzeitige Wohnraumentwicklung übertragbar.
Immobilien werden aufgrund des historisch niedrigen Zinsniveaus verstärkt als rentable Anlagemöglichkeit angesehen. Maßgeblich beschleunigt wurde die Spekulation auf dem Wohnungsmarkt durch verschuldete Kommunen, die in der Privatisierung ihrer Wohnungsbaugesellschaften den Ausweg aus der chronischen Unterfinanzierung der öffentlichen Haushalte sahen.
Deshalb kann man es nur begrüßen, wenn derzeit wieder von Gemeinnützigkeit die Rede ist. Denn augenscheinlich ist doch eine über das reguläre Instrumentarium zur Sicherung von preiswertem und gebundenem Wohnraum hinausgehende Intervention notwendig. Denn der Umfang der vorhandenen gebundenen Wohnungsbestände reicht nicht aus, um ein wirksames Marktkorrektiv zur Dämpfung der Preise zu bilden und um die Bedarfsgruppen angemessen zu versorgen.
Der soziale Wohnungsbau muss gewissermaßen wiederbelebt, vielleicht sogar neu erfunden werden. Denn zur Erhaltung oder Wiederherstellung des gesellschaftlichen Friedens braucht es Wohnraum und Wohnumfelder mit menschlichen Proportionen.