Forencheck: FFP2-Maskenpflicht, Gefahren des Kohleabbaus und möglicher Ersatz für Steinkohle aus Russland
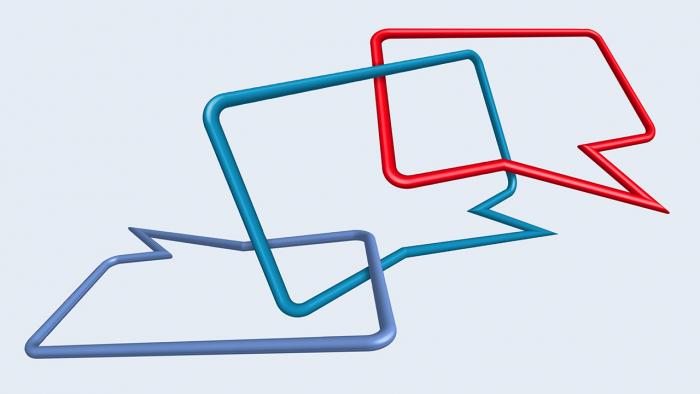
Drei Fragen aus dem Forum. Eine Telepolis-Kolumne
Deutsch-Österreichischer Sonderweg bei FFP2-Masken?
In Bezug auf den Artikel "Bundesgericht: Freiheitsentzug für Maskenverweigerer rechtens" kommentiert ein User:
Ich glaube die Mehrheit der Bürger ist sich nicht im Klaren, dass diese unsäglichen FFP2 Masken außer in Deutschland und Österreich in KEINEM anderen Land dieses Planeten je zwangsverordnet wurden. Das ist auch nachvollziehbar, denn FFP2 Masken sind ein Arbeitschutzprodukt zur Verwendung in Industrie und Handwerk, deren Verwendung klar definierte arbeitsschutzrechtliche Regeln folgt. Diese Dinger sind KEIN Medizinprodukt und der Einsatz zur "Seuchenbekämpfung" ist nicht indiziert. (…)
Auch wenn sich die Verordnungen zum Tragen von Masken aller Länder über die letzten zwei Jahre nicht ins Detail werden nachvollziehen lassen, müssen bei der FFP2-Maskenpflicht in Europa zumindest Tschechien und die Slowakei hinzugefügt werden. Dort waren FFP2-Masken ebenfalls u.a. in Geschäften, öffentlichen Verkehrsmitteln und Gesundheitseinrichtungen verpflichtend.
Auch Griechenland gab sich nicht mit dem Tragen einer einfachen medizinischen Maske zufrieden, dort mussten z.B. in Supermärkten entweder zwei OP-Masken übereinander oder eine FFP2/KN95-Maske getragen werden.
In anderen Ländern wurde ein Mund-Nasen-Schutz mit dem Standard FFP2 (oder dem Äquivalent KN95) für bestimmte Personengruppen und Kontexte zumindest empfohlen. So hat etwa das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) im Februar Empfehlungen zum Tragen von Masken in der Öffentlichkeit vor dem Hintergrund der Omikron-Variante veröffentlicht.
Darin wird u.a. "älteren Menschen, Personen mit medizinischen Grunderkrankungen, Hochrisikokontakten von Covid-19-Fällen, die nicht für die gesamte empfohlene Quarantänezeit in Quarantäne bleiben können und Covid-19-Fälle, die nicht über den gesamten empfohlenen Zeitraum isoliert werden können" das Tragen von Masken mit FFP2-Standard (englisch: respirator) empfohlen.
Es ist richtig, dass FFP2-Masken in erster Linie als Arbeitsschutzprodukt entwickelt wurden, etwa um zu verhindern, dass Stäube eingeatmet werden. Sie wurden aber auch schon vor der Covid-19-Pandemie im Gesundheitsbereich eingesetzt.
Nach einer gewissen Tragezeit sollte eine Pause erfolgen. "Vorgaben für eine feste Tragezeitbegrenzung sind nicht zu empfehlen, sondern sollten für die konkrete Tätigkeit getroffen werden", schrieb der Ausschuss für Arbeitsmedizin beim Bundesarbeitsministerium im Dezember 2021.
Die zu empfehlende Tragezeit sei etwa abhängig von der Schwere der Tätigkeit oder der Umgebungstemperatur.
Woher kommt die Steinkohle und wie gefährlich ist ihr Abbau?
Im Kontext des Artikels "EU-Kommission will neue Sanktionen gegen Russland" beschäftigen sich mehrere Kommentare mit der Frage, ob und wie importierte Steinkohle aus Russland ersetzt werden könnte. Ein User fragt:
1. Wird die [Steinkohle] in einfachst zugänglichen Tagebau gewonnen oder untertage?
2. Wenn untertage, mit welchen Arbeitsbedingungen inkl. Unfallgefährdung der Bergleute. Sind es geologisch günstigere Lagerstätten als die noch vorhandenen vielen deutschen Lagerstätten.
3. War der vor wenigen Jahren eingestellte Ruhrbergbau oder aus Ibbenbürren sicherer und inkl. Transportaufwand billiger? Lohndumping ist kein Grund für Importe oder billigen (Not)Strom!
Diese Frage wird z.T. direkt im Forum beantwortet. Wie schon richtig aufgeführt sind die wichtigsten Importländer Russland, Australien, die USA und Kolumbien.
Russland ist darunter das einzige Land, in dem die Kohle noch unter Tage gewonnen wird. Mit den Auswirkungen des Kohleabbaus in Russland setzt sich die russische Umweltschutzorganisation Ecodefense seit langen Jahren auseinander. (Deren Gründer Vladimir Slivyak wurde übrigens 2021 mit dem alternativen Nobelpreis ausgezeichnet).
Die Hauptabbauregion in Russland heißt Kuzbass, dort gibt es sowohl offenen Tagebau als auch Bergwerke unter Tage. Unter Tage kommt es – nicht nur in Russland – immer wieder zu schweren Grubenunglücken, berichtet wurde etwa im November 2021 über ein Unglück mit 52 Todesopfern.
Auch wenn der Tagebau sicherer für die Arbeitskräfte ist, für die Umwelt und Gesundheit der Bevölkerung hat er schwerwiegende Folgen. Ecodefense schreibt in einem Bericht, dass die Lebenserwartung in der Region Kuzbass drei bis vier Jahre kürzer sei als im russischen Durchschnitt.
Unter Tage wird Steinkohle derzeit noch in China, Indien und der Türkei abgebaut. Aus allen drei Ländern wird immer wieder von schweren Grubenunglücken berichtet. Als potenzielle Kohleimportländer kommen alle drei ohnehin nicht in Betracht – sie produzieren in erster Linie für den Inlandsmarkt. In Deutschland schloss die letzte Zeche im Jahr 2018, die hiesige Förderung war auf dem internationalen Markt nicht mehr konkurrenzfähig.
Zwischen 1974 und 1995 wurde der Steinkohleabbau in Deutschland über den sogenannten Kohlepfennig subventioniert.
Grubenunglücke wie zum Beispiel 1962 im Saarland gehörten dabei in Deutschland genauso zur Geschichte wie in anderen Kohleförderländern.
Wie könnte die russische Kohle ersetzt werden?
"Vorräte reichen vier bis sechs Wochen", zitiert ein User aus einem Bericht auf Yahoo.
Nun, zunächst wirkt diese Zahl nicht wirklich beunruhigend. Zumal Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck laut einem Bericht des Spiegels darüber nachdenkt, für den Winter eine Kohlereserve für die Kraftwerke aufzubauen, die für 30 Tage reichen würde.
Vier bis sechs Wochen scheinen da völlig im Rahmen, zumal auch die entsprechenden Lagerkapazitäten vorhanden sein müssten. Schließlich importiert Deutschland über 32 Millionen Tonnen Steinkohle pro Jahr. Das heißt, pro Woche werden in Kraftwerken und Industrieanlagen über 600.000 Tonnen Kohle verfeuert.
Mit mehr als 18 Millionen Tonnen stammt über die Hälfte der Steinkohleimporte aus Russland, mit weitem Abstand gefolgt von den USA, Australien und Kolumbien.
"Steinkohleimporte aus Russland können in wenigen Monaten vollständig durch andere Länder ersetzt werden. Insbesondere aus den USA, Kolumbien und Südafrika. Aber auch aus Australien, Mosambik und Indonesien", sagt Alexander Bethe, Vorstandsvorsitzender des Vereins der Kohlenimporteure e.V..
Ein Forenkommentar beschäftigte sich mit der Frage, ob für einen solchen Wechsel genügend Schiffe zur Verfügung stünden und ob der Transport zu zusätzlichen Emissionen führen würde. Aufgrund des enormen Transportvolumens auf See ist die globale Schifffahrt zwar eine wichtige CO2-Emittentin, laut Umweltbundesamt ist der Schiffstransport aber weniger CO₂-intensiv als der Transport auf der Schiene:
Die meisten Schiffe verbrauchen pro Tonnenkilometer im Vergleich zu Lkw oder Bahn deutlich weniger Kraftstoff. Die Werte können aber je nach Schiffs- oder Lkw-Größe stark variieren.
Kohle wird in Frachtschiffen mit Kapazitäten von zum Teil mehr als 100.000 Tonnen transportiert, sodass hier keine enormen zusätzlichen Schiffsbewegungen zustande kämen.
In Hinblick auf den CO₂-Ausstoß wäre es am besten, die Kohleimporte durch erneuerbare Energieträger zu ersetzen, der Schiffstransport spielt da kaum eine Rolle. Und auch im Hinblick auf Umweltfolgen und Menschenrechtsverletzungen ist die Kohle aus Übersee keine Alternative zu russischen Importen. Vornehmlich werden von internationalen Organisationen immer wieder Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit dem kolumbianischen Tagebau "El Cerrejón" angeprangert. Aber auch aus Südafrika und Indonesien wird über eine Kriminalisierung von Kohlegegner:innen berichtet.
