Kommentar: Selbstbeweihräuchernde Partei Deutschlands
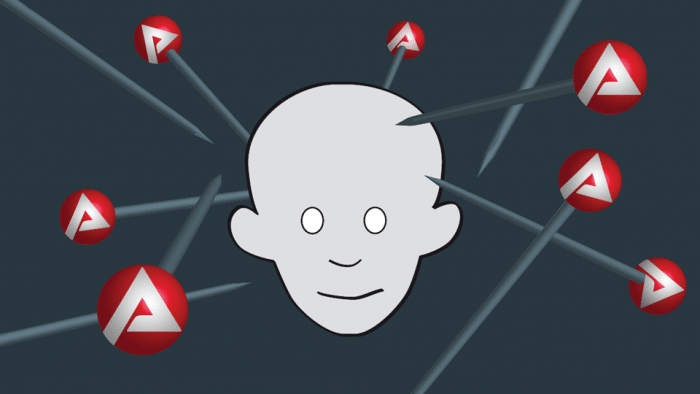
Grafik: TP
Die SPD bejubelt ihren Neuanfang und die Abkehr von HartzIV. Warum eigentlich?
Vor etwas mehr als zwei Jahren, am 1. März 2017 trat Hannelore Kraft am politischen Aschermittwoch in Schwerte auf. Sie war nicht allein, an ihrer Seite war der Mann, der der SPD zu neuem Glanz verhelfen sollte, der den "kleinen Mann" als den Menschen wiederentdeckte, der der SPD am Herzen liegen sollte, und zu dessen Ehren "When the Saints are Marching in" gespielt wurde: Martin Schulz.
Die SPD befand sich zu jener Zeit in einer Art Rausch. Martin Schulz, der EU-Abgeordnete, war nach Deutschland gekommen und lieferte den Medien wie auch der SPD markige Sprüche und Gefühlvolles im Wechsel. "Wir treten an, um die stärkste Partei in Deutschland zu werden. Ich trete an, um Bundeskanzler zu werden", rief er selbstbewusst und seine Partei fühlte, wie es in der FAZ hieß, wieder Euphorie.
Martin Schulz wurde als der große HartzIV-Reformator gefeiert, als Hoffnung für SPD und Deutschland, doch allzu schnell war der Schulz-Zug wieder auf ein Abstellgleis gefahren, Martin Schulz geriet zum größten Teil in Vergessenheit, die SPD, die anfangs eine Große Koalition ausgeschlossen und verkündet hatte, sie würde in die Opposition gehen, entschloss sich anders.
Déjà Vu
Wer die SPD momentan beobachtet, fühlt sich an die Zeit des Schulz-Zuges erinnert, an feiernde Genossen und wiederentdeckte soziale Profile. Diesmal ist es nicht Martin Schulz, der im Zentrum der Euphorie steht, sondern Andrea Nahles. Ihre Vorschläge zur "Abkehr von Hartz IV" werden als großer Befreiungsschlag angesehen, als Linksruck und Neuausrichtung. Doch während bei Martin Schulz seine mangelnde Erfahrung im Bereich der deutschen Sozialpolitik noch als Grund für seine nur unausgegorenen und größtenteils auf Arbeitslosengeld I ausgerichteten Ideen gelten konnte, ist dies bei Andrea Nahles nicht der Fall.
Von 2013 bis 2017 war sie Bundesministerin für Arbeit und Soziales und hätte, wäre ihr das Arbeitslosengeld II solch ein Dorn im Auge, hier bereits den Hebel ansetzen können, um es den Beziehern dieser Transferleistung leichter zu machen. Das Gegenteil war der Fall. Ihre diversen Aktivitäten in Bezug auf ALG II waren geprägt von einer Art Verschiebebahnhof der Gelder, von der Konzentration auf die Langzeitarbeitslosen und auf die Förderung, die Andrea Nahles immer wieder in den Vordergrund rückte, als sei diese Aufgabe eine, die erst jetzt Eingang in ALG I und II finden sollte.
Dass ALG II unter der Prämisse "Fordern und Fördern" stand, dass daraus aber längst nur noch ein "Fordern und Fordern" wurde, bleibt dabei elegant außen vor. Die Förderung in regelmäßigen Abständen wieder als "next big thing" herauszustellen, zeugt von einer gewissen Chuzpe, aber auch von der Ratlosigkeit nicht nur bei Andrea Nahles.
Andrea Nahles und ALG II - die große Seifenblase
Die Kritik an Andrea Nahles klingt wie eine der "üblichen SPD-Kritiken", fußt jedoch auf nachvollziehbaren Fakten. Ihre einzelnen Verbesserungsvorschläge hinsichtlich ALG II können daher einzeln auf das, was Frau Nahles bisher diesbezüglich getan hat, abgekopft werden. Dieser Betrachtung liegt das Dokument "Arbeit - Solidarität - Menschlichkeit. Ein neuer Sozialstaat für eine neue Zeit - Teil I: Arbeit" zugrunde.
Anhebung der Bagatellgrenze
Einer der letzten Punkte in der Absichtserklärung ist die Erhöhung der Bagatellgrenze bei Rückforderungen. Einfach erklärt gibt es einen Betrag, bei dem das Jobcenter gewissermaßen sagt: "Hier würde eine Rückforderung zu viel Personal und Zeit benötigen, also vergessen wir sie einfach". Eine Praxis, die beispielsweise vor etlichen Jahren auch bei der Bezahlung von Strafen für ordnungswidriges Parken angewandt wurde. Kenner dieser Praxis überwiesen letztendlich nie die gesamte Summe - wohlwissend, dass der fehlende Betrag unterhalb der Bagatellgrenze lag.
Eine Anhebung dieser Bagatellgrenze ergibt daher Sinn, würde sie doch dazu führen, dass die Jobcenter nicht damit beschäftigt wären, sich mit geringfügigen Rückforderungen zu befassen. Für die Jobcenter gab es bereits einen Spielraum, was die Rückforderungen angeht - ob sie in solchen Fällen tätig wurden, lag in ihrem Ermessen. Dieser Spielraum lag bei Beträgen bis zu 7 Euro.
2015 kam es jedoch zu einer Änderung: Die Bagatellgrenze wurde aufgehoben. Sämtliche Forderungen, so die Weisung zweier Bundesminister, sollten auf "Soll" gestellt und erfasst werden, die Fallzahlen begannen in die Höhe zu schnellen. Das Ergebnis sind Rückforderungen in Höhe von 18 Millionen Euro an Kleinbeträgen unter 50 Euro, die unter Einsatz von rund 60 Millionen Euro durchgesetzt wurden. Die beiden Bundesminister, die diese Weisung gaben, waren Wolfgang Schäuble und Andrea Nahles.
Vier Jahre nachdem also Frau Nahles gemeinsam mit Wolfgang Schäuble dafür sorgte, dass die bisherige Bagatellgrenze nicht mehr berücksichtigt wurde, ist nun in ihrem neuen Grundsatzprogramm zu finden, dass sie die Bagatellgrenze anheben will. Wenn aber die Weisung, die Bagatellgrenze nicht zu berücksichtigen, weiter besteht, würde eine Anhebung dieser Grenze letztendlich lediglich eine kosmetische Veränderung bedeuten. Über die frühere Weisung, die Grenze nicht zu beachten, verliert Frau Nahles jedoch kein Wort.
Unterstützung darf niemals als Stigma verstanden werden
"Der Sozialstaat muss die Würde des Einzelnen achten. Unterstützung zu brauchen, darf niemals als Stigma empfunden werden", so liest es sich in dem Konzept, das zur Zeit (nicht nur) von der SPD gefeiert wird:
Mit diesem Konzept eröffnen wir eine Reihe von Reformvorschlägen zum 'Sozialstaat für 7 eine neue Zeit'. Antworten für die Sozialstaatsbereiche der Alterssicherung, Gesundheit 8 sowie Pflege und Wohngeld werden folgen. Hier konzentrieren wir uns auf Chancen und 9 Schutz in der neuen Arbeitswelt.
Wer deutliche Worte zu den letztjährigen Bemühungen mancher SPD-Granden zum Thema ALG II erwartet, wird enttäuscht. Andrea Nahles wischt diese Kommentare nicht beiseite, sie ignoriert sie einfach, als hätten sie nie stattgefunden.
Egal, ob Wolfgang Clement und seine herbeifabulierte "25% Missbrauchsquote", Kurt Becks Rasurempfehlungen oder Thilo Sarazzins Tiraden - die vielen kleinen oder großen Beiträge der SPD, um ALG II-Empfänger als Parasiten und Schnorrer, als faule Arbeitsunwillige, dastehen zu lassen, werden mit keiner Silbe erwähnt. Stattdessen wird eine Selbstverständlichkeit als etwas Besonderes verkauft: "Der Sozialstaat muss die Würde des Einzelnen achten."
Wer meint, dies sei eine sehr gute Idee, dem muss beigepflichtet werden. Denn dies ist immerhin der erste Artikel des deutschen Grundgesetzes:
Art 1. (1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. (2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.
Was hier also in dem neuen Sozialstaatkonzept betont wird, ist nichts anderes, als dass sich die staatliche Gewalt (also auch die in einem Jobcenter) zu Artikel 1 GG bekennt. Tatsächlich wäre alles andere grundgesetzwidrig. So ist also dieser Satz allein schon ein Blendwerk. Eine Idee, die wie eine Selbstverständlichkeit als positive Neuerung dargestellt wird.
Entweder haben sich die Jobcenter bisher grundgesetzwidrig verhalten, indem sie den Artikel 1 GG nicht beachtet haben - oder aber sie haben dies stets getan, so dass dieser Satz in dem neuen Konzept irrelevant ist. Gleiches gilt für den Satz: "Und das heißt schließlich: Der Sozialstaat muss den Einzelnen und sein Schicksal respektieren."
Deutschland ist und bleibt eine Arbeitsgemeinschaft
Der Satz an sich ist letztendlich nicht nur eine Plattitüde, er verhindert von Anfang an auch eine Auseinandersetzung mit den Fragen, die sich um die "Arbeit" drehen:
- Was bedeutet Arbeit für den Einzelnen?
- Wann ist Arbeit tatsächlich sozial?
- Ist Arbeit um jeden Preis wirklich hilfreich?
- Ist die allgegenwärtige Konzentration darauf, dass Menschen sich eben als Mitglied der Gesellschaft fühlen sollen, wenn sie arbeiten, nicht vielmehr das Problem?
Antwort auf die Frage, in welcher Position Frau Nahles die Arbeit sieht, gibt folgender Satz des Konzepts:
Die Grundpfeiler unseres Sozialstaatsversprechens sind Arbeit, Solidarität, und Menschlichkeit.
Menschlichkeit steht hier an letzter Stelle noch hinter der Solidarität, die selbst hinter der Arbeit steht. Die Arbeit wird also als Grundpfeiler des Sozialstaatsversprechens gesehen, so dass von Anfang an dieser Aspekt als unbedingte Tatsache für weitere Kommentare steht.
Die folgende Erläuterung dieses Konzeptes liest sich demnach auch wie eine längere Liste von Phrasen:
Das heißt zunächst: Den Sozialstaat auf der einen Seiten und die Bürgerinnen und Bürger auf der anderen Seite verbinden gegenseitige Rechte und Pflichten. Das heißt weiter: Die Leistungen des Sozialstaats sind soziale Rechte, die Bürgerinnen und Bürger zustehen. Sie sind Inhaberinnen und Inhaber dieser Rechte, keine Bittsteller. Das heißt außerdem: Der Sozialstaat hat gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern eine Bringschuld, nicht andersrum die Bürgerinnen und Bürger gegenüber dem Sozialstaat eine Holschuld. Und das heißt schließlich: Der Sozialstaat muss den Einzelnen und sein Schicksal respektieren. Er muss Instrumente schaffen, die den individuellen Anforderungen und unterschiedlichen Problemstellungen der Menschen gerecht werden.
Nichts von alledem klingt schlecht, aber es sind Selbstverständlichkeiten. Wer meint, dass diese Absichtserklärungen oder Konzepte gut klingen, dem sei empfohlen, einmal jeden Satz in das Gegenteil umzukehren und zu schauen, ob sich dies überhaupt mit einem Rechtsstaat und seinen Gesetzen vereinbaren ließe. So wird klar, dass hier einfach nur eine Liste von Aspekten, die sich aus dem deutschen Rechtssystem automatisch ergeben, als eine Liste dargestellt wird, die innovativ für ein neues Sozialsystem ist.
Wir haben auch eine Verantwortung gegenüber denen, die für wenig Geld arbeiten gehen
Dem Redationsnetzwerk Deutschland (einem Inhaltezulieferer der Madsack-Gruppe, bei der das SPD-Medienbeteiligungsunternehmen größte Kommanditistin ist) sagte Andrea Nahles, dass die Regelsätze des ALG II unangetastet bleiben würden: "Wir haben auch eine Verantwortung gegenüber den Menschen, die für wenig Geld jeden Tag zur Arbeit gehen. Wenn wir denen das Gefühl geben, dass sich ihr Einsatz finanziell nicht mehr lohnt, zerstören wir jede Motivation." Zusätzliches Geld sollten Leistungsempfänger aber zum Beispiel über "ein Bonussystem für Weiterbildung und auch bei speziellem Bedarf" bekommen.
Angesichts der Tatsache, dass sich Gerhard Schröder einst rühmte, den besten europäischen Niedriglohnsektor geschaffen zu haben, ist diese Aussage bestenfalls zynisch. Angesichts der oft mehr als mageren Löhne beziehungsweise Gehälter heißt dies also, dass sich ein sehr geringer Regelsatz (unabhängig davon, welche Fehler bei seiner Ermittlung gemacht wurden) dadurch rechtfertigen lässt, dass jemand, der einer Erwerbstätigkeit nachgeht, genauso wenig erhält als würde er ALG II beziehen - oder nur geringfügig mehr.
Dazu kommt, dass Andrea Nahles keineswegs auf den Aspekt eingeht, dass gerade ALG II-Empfänger dazu gezwungen sind, auch minderbezahlte Tätigkeiten anzunehmen, da sonst eine Sanktion droht, die bis zu einem vollständigen Einbehalten der Leistungen führen kann.
Teil 2: Sanktionen, Langzeitarbeitslosenförderung und weitere Nebelkerzen
Empfohlener redaktioneller Inhalt
Mit Ihrer Zustimmmung wird hier eine externe Buchempfehlung (Amazon Affiliates) geladen.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen (Amazon Affiliates) übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
