"Kritik ist immer erlaubt und wichtig"
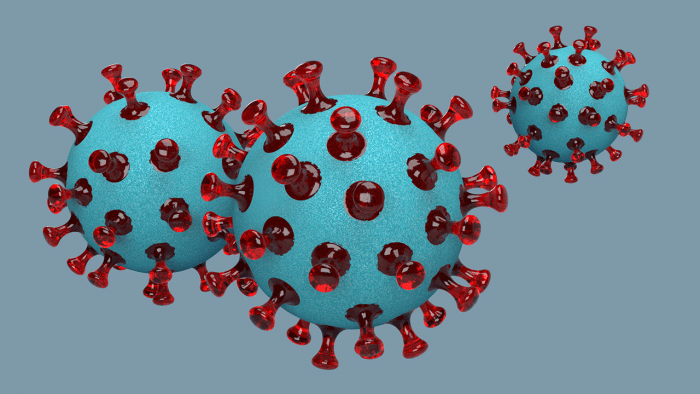
Gespräch mit Medienethiker Prof. Christian Schicha über Journalismus in Corona-Zeiten
In der Journalistik wird allmählich die erste Kritik an der Corona-Berichterstattung laut, noch sicherlich auf dünnem Eis, viele Forschungsprojekte werden folgen. Wie haben Sie den Journalismus über die Pandemie bisher wahrgenommen?
Christian Schicha: Die Berichterstattung habe ich über eine recht lange Zeit als relativ konform wahrgenommen. Da drängt sich die Analogie zur Flüchtlingsberichterstattung 2015 auf. Damals gab es am Anfang in der Bevölkerung eine spontane Begeisterung und viel Engagement, den armen Menschen zu helfen, und das war auch in den Medien ganz überwiegend Konsens. Die Politik der Regierung wurde kaum kritisch bewertet. Ähnlich ist es jetzt auch: Mit Ausbruch der Pandemie waren sich alle einig, dass man das soziale Leben herunterfahren muss, dass es maximalen Schutz geben muss und vor allem, dass die Maßnahmen der Politik praktisch fraglos akzeptiert worden sind. Das war tatsächlich eine Art Gleichklang, aber das ändert sich allmählich.
Der Schweizer Medienforscher Vinzenz Wyss findet es richtig, dass Journalisten "nicht mit vorauseilender Kritik an Behördenentscheiden noch mehr zur Verunsicherung beigetragen haben".
Christian Schicha: Soweit würde ich nicht gehen. In der Analyse stimme ich ihm zu, dass in einer solchen Ausnahmesituation mit einer völlig neuen Krankheit der Gesundheitsschutz das höchste Gut sein sollte, und dass von journalistischer Seite alles getan werden muss, damit dieser Gesundheitsschutz auch gewährleistet werden kann, damit es nicht zur Überlastung des Gesundheitswesens kommt.
Aber ich würde grundsätzlich immer die Prämisse aufstellen, dass die Rolle von Journalistinnen und Journalisten nie die sein sollte, quasi als Pressesprecher der Regierung zu fungieren, sondern dass man immer jede Position stets kritisch hinterfragen muss. Es muss nachrecherchiert werden, denn es müssen auch divergierende Standpunkte und Kritik, so sie begründet sind, zu hören sein. Eine Demokratie lebt vom Streit, von der Auseinandersetzung, von kontroversen Debatten. Auch konträre Einschätzungen und Widersprüche können konstruktiv und zielführend sein. Kritik ist immer erlaubt und wichtig, aber auf der Grundlage von Vernunft, von Argumentation, von Quellenprüfung und dergleichen.
Wyss und andere haben den Gleichklang der Medien mit Verantwortungsethik begründet. Das hat mich irritiert, denn aus der Verantwortungsethik kann sich doch nicht ergeben, dass der Journalist anstelle des Souveräns denkt und entscheidet. Denn dafür hat der Journalismus doch gar kein Mandat. Oder wo beginnt es, dass Journalisten zu Recht sagen, wir behalten Informationen für uns und stellen sie dem Souverän nicht zur Meinungsbildung zur Verfügung?
Christian Schicha: Journalistinnen und Journalisten sollen Informationen nur dann zurückhalten, wenn Gefahr im Verzug ist, also etwa bei einer Entführung, sofern die Berichterstattung Menschen gefährden würde. Die Verantwortungskategorie ist hier bei der Pandemie und den politischen Gegenmaßnahmen schwierig, weil sich immer die Frage stellt, welche Akteure in den Entscheidungsprozessen auf welcher Basis und Kompetenz das politische Handeln mit beeinflussen.
Christian Drosten, einer der berühmtesten Virologen, hat deshalb darauf hingewiesen, als er heftig attackiert wurde, dass die Rollenverteilung falsch wahrgenommen wird. So wurde unterstellt, dass er politisches Handeln bestimmt. Die Wissenschaft stellt Drosten zufolge allein wissenschaftliche Fakten und deren Bewertungen zur Verfügung, aber sie entscheidet nichts. Das ist Sache der Politik. Insofern ist der Verantwortungshorizont allein auf Politikerinnen und Politiker verlagert, denn die müssen die Geldmittel umverteilen, die Gesetze machen, für Einschränkungen und die Aufhebung von Einschränkungen sorgen und vieles mehr.
Deshalb sehe ich wie Drosten da gar nicht als erstes die Journalistinnen und Journalisten in der Verantwortung, sondern die Politik. Natürlich haben auch die Journalistinnen und Journalisten immer eine Verantwortung für ihre Arbeit: Sie sollten keine Panik schüren, keine Verschwörungstheorien verbreiten etc. Aber sie verantworten und rechtfertigen nicht die politischen Entscheidungen. Und das ist auch nicht ihre Aufgabe.
"Schon die Dominanz des Themas in Frage zu stellen, ist ein konstruktiver Ansatz"
Wer die publizistische Verantwortungsethik so hoch hält, müsste im Falle von Corona doch auch die Verantwortung für alle unterlassene Kritik und für die Folgen des von den Medien begrüßten Shutdowns übernehmen, also für alle Nebenwirkungen und für die Billionen Euro, die jetzt von künftigen Generationen genommen werden. Um diese Verantwortung wenigstens theoretisch tragen zu können, müsste man dann natürlich alle Folgen schon kennen.
Christian Schicha: Völlig richtig. Es geht um das journalistische Agieren auch unter Unsicherheit. Gerade weil wir eine völlig neue Situation hatten, muss solide recherchiert werden. Es genügt nicht, eine Mehrheitsmeinung zu verbreiten. Journalismus hat gerade auch in solch schwierigen Zeiten sein Handwerk der Recherche zu machen. Und wenn sich da alle Akteure sehr einig sind in ihren Einschätzungen der Pandemie, der nötigen Maßnahmen und der Konsequenzen, dann ist es ja gerade die Aufgabe eines konstruktiv-kritischen Journalismus, den Finger in die Wunde zu legen und Fragen zu stellen.
Die erste Frage, die sich in solchen Situationen immer stellt: Ist die Dominanz des Themas überhaupt angemessen? Was fällt dadurch aktuell unter den Tisch, was wird nicht berichtet, was bleibt außerhalb der öffentlichen Beobachtung? Das sage ich auch als Mitglied der Initiative Nachrichtenaufklärung. Derzeit haben wir jeden Tag nach der Tagesschau eine Sondersendung, mit den immer gleichen Akteuren, den gleichen Statements. Also schon die Dominanz des Themas in Frage zu stellen, ist ein konstruktiver Ansatz.
Beim Corona-Thema selbst ist es eine wichtige Aufgabe, sich die Macht- und Lobbyverhältnisse anzuschauen. Wenn beispielsweise die Krankenschwestern beklatscht werden, aber unter katastrophalen Bedingungen arbeiten müssen, während die Autoindustrie oder vielleicht auch die Fußball-Bundesliga als starke Lobbygruppen bei der Politik sehr erfolgreich sind, dann wünsche ich mir einen kritischen Journalismus. Das kommt jetzt alles sukzessive, aber am Anfang sind Einordnungen und Meinungsvielfalt sicherlich zu kurz gekommen.
"Es gibt kaum eine begründete Medienkritik gegenüber anderen Medien"
Als Frühwarnsystem prädestiniert wäre da der Medienjournalismus ...
Christian Schicha: Der Medienjournalismus hat strukturelle Probleme, die zahlreiche Medien haben. Da ist die Umsonst-Mentalität der Nutzer, es agieren unheimlich viele Leute auf sehr vielen Plattformen, da ist die Kernfrage, wie Medienjournalismus finanziert werden kann. Selbst im öffentlich-rechtlichen Fernsehen haben wir nur eine Sendung dafür, ZAPP, am späten Mittwochabend. Ansonsten findet im Fernsehen kaum kritischer Medienjournalismus statt.
In den Zeitungen ist es auch sehr überschaubar, da ist die Medienseite dann eine Fernsehprogrammseite oder eine Kulturseite. Und das alte Sprichwort, dass die eine Krähe der anderen kein Auge aushackt, trifft sicherlich auch auf den Medienjournalismus zu, so dass es kaum eine begründete Medienkritik gegenüber anderen Medien gibt. Da hält sich der Journalismus leider recht bedeckt. Gerade aus wissenschaftlicher Sicht wünsche ich mir Medienkritik im Journalismus selbst. Die Medienwissenschaft ist da recht träge, Forschung braucht eben Zeit, und bis dann Ergebnisse vorliegen ist das Thema meist schon durch.
Die journalistische Medienkritik hat allerdings gerade bei der Einordnung von Corona-Berichterstattung Probleme, den eigenen Glauben hintanzustellen. Um einen prominenten Vertreter zu nennen: Stefan Niggemeier, ein scharfer, aber stets fairer Medienjournalist, arbeitet sich an Kollegen wie Jakob Augstein ab, die mit dem gesundheitspolitischen Kurs nicht einverstanden sind.
Dass Augstein und Jan Fleischhauer gemeinsam einen Corona-Podcast machen, obwohl sie keine epidemiologischen Experten sind, hält er "nicht für Journalismus". Zu einem Kommentar unter dem Titel "Maulkorb des Volkes" über die "Maskenpflicht" twittert Niggemeier über den Autor: "Stern-Kolumnist Hans-Ulrich Jörges hat es auch erwischt." Von Medienkritik betroffene Journalisten wie der ehemalige FAZ-Herausgeber Werner D'Inka weisen die wissenschaftliche Medienkritik pauschal zurück.
Christian Schicha: Wir sollten nicht auf einzelne Personen fokussieren, dann ist man schnell bei den Debatten über politisch Links und Rechts, dann bekommt jeder Journalist oder jede Journalistin ein oberflächliches Etikett. Augstein ist u.a. bei Maischberger sehr polarisierend aufgetreten und hat sich sehr kritisch geäußert. Seine Hauptkritik ist, wenn ich es richtig verstanden habe, dass wir mehr oder minder alles mitmachen, was die Politik derzeit vorgibt, und die persönlichen Einschränkungen des Lebens nicht hinterfragen.
Damit sollte man sich kritisch auseinandersetzen. Man muss Argumente, die einem nicht passen, mit Argumenten entkräften. Ich wünsche mir einen offenen Diskurs, der ggf. auch polarisierend sein darf, sehr kontroverse Meinungen, die dann der eigenen Meinungsbildung dienen. Zu sagen, jemand erzähle nur Schwachsinn, ist an sich natürlich kein Argument, das muss belegt werden, das braucht Recherche. Persönliche Beschimpfungen führen in der Sache nie weiter.
Aber wie sieht es aus mit den Fakten? Hätte der Journalismus nicht beispielsweise von Anfang an thematisieren müssen, wie weit überhaupt jemals wissenschaftlich überprüfbar sein wird, ob die derzeitigen politischen Maßnahmen nützlich waren, zu wenig oder zu viel gesteuert haben? Wissenschaftlich betrachtet haben wir doch ein multifaktorielles Design, bei dem wir am Ende kaum den Effekt einer einzelnen Maßnahme prüfen können.
Um mal ein Beispiel zu nennen: Als die Maskenpflicht für öffentliche Verkehrsmittel und Geschäfte in den Bundesländern verordnet wurde, hat sich Bremen als letztes Land angeschlossen. Wenn zu diesem Zeitpunkt die ursprüngliche Parole "Flatten the Curve" noch gültig gewesen sein sollte, hätte doch Bremen besser auf eine Anpassung an die anderen Länder verzichtet und wir hätten vielleicht ein Vergleichsmodell gehabt, um später den Nutzen einer solchen Vorschrift auswerten zu können. Ich möchte nicht über die Maskenpflicht diskutieren, mich interessiert nur, ob der Journalismus nicht hätte auf dieses systemische Problem hinweisen müssen. Stattdessen finden wir schon heute fragwürdige Kausalschlüsse der Art: Dass der Lockdown viel gebracht habe, könne ein jeder an den Zahlen sehen.
Christian Schicha: Methodisch ist das sicherlich schwierig, das ist richtig. Um das Dilemma zu lösen, blicken viele derzeit nach Schweden, wo es verhältnismäßig wenige Beschränkungen für das öffentliche Leben gab. Aber Schweden und Deutschland sind eben sehr unterschiedlich, allein von der Bevölkerungsdichte. Ein Experiment wie von Ihnen vorgeschlagen hätte allerdings ganz andere ethische Probleme, wenn man Menschen Schutzmaßnahmen vorenthält.
Es geht mir selbstverständlich nicht um Experimente an und mit Menschen, sondern allein um die politische Vorgabe, die hieß: "Flatten the Curve", wir müssen das Gesundheitssystem aufrechterhalten. Es hieß ja nie: Alle Menschen müssen eingesperrt werden, bis wir einen Impfstoff haben. Daher wäre die Krankenversorgung nun wahrlich nicht bedroht, wenn das kleine Bremen einen anderen Weg gegangen wäre, die Krankenhäuser in der Umgebung stehen ja derzeit überwiegend leer. Aber es geht mir ja gerade nicht darum, was die richtige Politik wäre, sondern wie der Journalismus die reale Politik darstellen sollte. Würde dazu nicht gehören, die Grenzen der wissenschaftlichen Auswertung aufzuzeigen?
Christian Schicha: Ministerpräsident Armin Laschet sagt zurecht, es geht um Leben und Tod. Alles, was derzeit beschlossen wird, kann immense Auswirkungen haben, natürlich in jede Richtung. Die Datenbasis ist aber bisher sehr dünn.
Als direkt am Anfang der Pandemie in den Medien immer Zahlen von Corona-Infizierten genannt wurden, habe ich mich schon gewundert, denn wir hatten ja tatsächlich gar keine Ahnung, wie viele Infizierte es gibt, es gab nur Meldungen der Gesundheitsämter und Krankenhäuser, aber niemand konnte wissen, wie viele Menschen sich zu diesem Zeitpunkt mit dem Corona-Virus infiziert hatten. Da gab es in der Kommunikation sehr viel Unsicherheit, die nicht so benannt worden ist.
Derzeit wird viel über den sogenannten R-Wert berichtet, also die Reproduktionszahl des Corona-Virus, und das politische Ziel ist offenbar nicht mehr eine Beherrschbarkeit der Epidemie, sondern ihr Stopp. Das ist ein deutlicher Kurswechsel gegenüber dem, was wir im März lesen und hören konnten. Ist dieser Wechsel vom Journalismus nachvollziehbar erklärt und zur Diskussion gestellt worden?
Christian Schicha: Es gab in der Tat viele Widersprüche und Meinungsänderungen, sowohl bei den Experten als dann auch bei der Politik. Masken galten zunächst als nutzlos, dann als Virenschleudern, heute sind sie ein wichtiges Mittel, um Infektionen zu verringern. Auch beim R-Wert wurden im Laufe der Zeit sehr unterschiedliche Ziel benannt.
Es ist völlig normal, dass sich bei einer solch dynamischen Entwicklung, wo täglich neue Forschungsergebnisse hinzukommen, die Einschätzungen ändern. Umso wichtiger ist es, auch mal zu sagen, dass man nichts Genaues weiß. Wir sind natürlich ständig Risiken ausgesetzt, die mehr oder weniger billigend in Kauf genommen werden. Darüber muss man reden, aber es ist schwierig mit einem Absolutheitsanspruch. Wir schaffen ja auch nicht den Autoverkehr ab, obwohl er viele Menschen verletzt oder tötet - bisher schaffen wir noch nicht einmal eine sinnvolle Geschwindigkeitsbegrenzung. Daher muss der Journalismus sicherlich auch die Konsequenzen der Lockdown-Maßnahmen recherchieren, also die negativen Folgen dessen, was gut gemeint ist.
Dazu hat Boris Palmer etwas gesagt, was in den Medien auf folgendes Fragment verkürzt wurde: "Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären, aufgrund ihres Alters und ihrer Vorerkrankungen." Das wurde nicht nur von konkurrierenden Politikern, sondern auch von Journalisten ganz überwiegend als Grenzüberschreitung kommentiert. Hat Palmer hier eine ethische Grenze überschritten?
Christian Schicha: Der Tübinger Oberbürgermeister schafft es immer wieder, mit provokanten Aussagen Aufmerksamkeit zu erzeugen. Die Nachrichtenfaktoren werden damit wunderbar bedient. Das Zitat ist natürlich eine Verkürzung, die Widerspruch fordert. Zumindest wird man aber darüber nachdenken dürfen, ob jemand an oder mit Corona gestorben ist. Auch ein halbes Jahr längeres Leben kann selbstverständlich für die Betroffenen ein großer Gewinn sein, und pauschale Altersgrenzen für medizinische Behandlungen wie etwa in Großbritannien sind ethisch schwer zu rechtfertigen. Aber es geht auch in der Medizin immer um Verteilungsfragen, die müssen diskutiert werden, und dazu muss der Journalismus sie stellen.
"Man darf von Journalisten auch nicht zu viel erwarten"
War die Berichterstattung zu dem Zitat-Fragment von Palmer nicht ein typisches Beispiel für Skandalisierung und damit für eine Nicht-Orientierungsleistung des Journalismus? Der viel zitierte Satz war ja gar keine Forderung, sondern eine Fragestellung; außerdem sagte Palmer genau in dem Zusammenhang, dass aufgrund des Shutdowns andere sterben werden, konkret bezog er sich auf einen UN-Bericht zum geschätzten Armutsdruck. Ein solcher Verweis ist doch schwerlich als empathielos zu bezeichnen. Aber wenn das geschieht, wo ist dann die Orientierungsleistung des Journalismus?
Christian Schicha: Es mögen auch hier die ökonomischen Zwänge und Kürzungsnotwendigkeiten des Journalismus sein, die es so verlockend machen, lieber über einen einzigen Satz zu diskutieren, anstatt das damit angesprochene Thema zu recherchieren und unaufgeregt die verschiedenen Aspekte daran herauszuarbeiten. Ich habe den Eindruck, der ein oder die andere der Medienberichterstatter denkt, mit solch tieferen Analysen seien die Hörer oder Leser überfordert.
Die Statements werden ja auch immer kürzer. Wenn ich eine dreiviertel Stunde mit einem Reporterteam spreche, werden davon im besten Falle zwei Minuten gesendet, ohne dass alles Übrige, was ich gesagt habe, sinnvoll zusammengefasst würde. Da kann ich auch die Kritik von Politikern wie etwa Otto Schily verstehen an diesem ständigen Verkürzen auf Schlagzeilen, auf das, was sich gut klickt, was geteilt und gelikt wird, wobei jede Herleitung, jedes Abwägen weggeschnitten wird. Im Boulevardjournalismus ist das zu erwarten, aber ein Qualitätsjournalismus darf so nicht arbeiten.
Sie sprechen von ökonomischen Zwängen, die Journalismus gelegentlich hinter seinen Möglichkeiten bleiben lassen. Sind es nicht manchmal einfach handwerkliche Defizite, wenn wichtige Fragen nicht recherchiert werden?
Christian Schicha: Man darf von Journalisten auch nicht zu viel erwarten. Es sind Menschen, und Menschen machen Fehler, haben Gefühle, Vorlieben, Ängste und so weiter. Mein Kollege Carsten Brosda, inzwischen Senator für Kultur und Medien in Hamburg, hatte das in seiner Doktorarbeit sehr schön dargestellt, indem er darauf hingewiesen hat, Journalistinnen und Journalisten stellen Öffentlichkeit her und sind Vermittler, aber sie sind auch Diskurs-Teilnehmer. Sie sind Bürgerinnen und Bürger mit eigenen Interessen, Meinungen, Vorurteilen usw. In der Wissenschaft ist das natürlich genauso.
Wir haben alle unseren subjektiven Blick, wir haben alle eine eigene Schere im Kopf, wir agieren in unseren Filterblasen und Echokammern. Das muss man Journalistinnen und Journalisten auch zugestehen.
Vom Journalismus würde ich mir daher wünschen, im Zweifelsfall auch deutlich zu sagen: Wir wissen es einfach nicht. Wir haben zwar diese und jene Informationen, die wir auch gerne weitergeben, aber für eine fundierte Bewertung und Einordnung fehlt uns noch die Zeit. Einfach zuzugeben, dass man etwas nicht weiß, finde ich kein Zeichen von Schwäche oder Faulheit, sondern Zeichen einer sinnvollen Reflexion.
Der Spiegel-Redakteur Jonas Schaible bezeichnete kürzlich in einem Twitter-Thread den Vorwurf journalistischer Einseitigkeit als "revisionistische Erzählung". Er schrieb, stark gekürzt:
"Ich sehe jetzt schon Anzeichen, dass sich zu Corona wieder eine revisionistische Erzählung etablieren könnte, wie 2015 ("Medien und Politik haben alles nur beklatscht") und 2016 ("niemand hat Trump ernst genommen, 'wir' sind schuld an Trump"). Ich rechne jedenfalls damit. Die ginge dann jetzt so: Hätte man früher auf die Kritiker_innen gehört, hätte sich Verschwörungsideologen nicht ausbreiten können. Es wäre das gleiche Muster: Radikalisierung als angebliche Folge davon, dass Anliegen nicht ernst genommen wurden. Nur wäre es wieder nicht wahr. Es ist nicht so, als wären keine abweichenden Positionen vertreten worden - es wurden und werden nur nicht genau die Positionen vertreten, die jetzt maßgeblich auf den Anti-Corona-Demos vertreten werden (weil sie weitgehend Bogus sind). [...] Keine Ahnung, woher genau diese Idee ihren Reiz gewinnt, Radikalisierung entstehe immer daraus, dass sinnvolle Kritik und Sorgen nicht gehört worden wären, aber sie war 2015 falsch, sie war 2016 falsch und, für den Fall, dass sie sich verbreitet: Sie ist jetzt falsch."
Christian Schicha: Da ist etwas dran. Wenn sich Menschen zu einig sind, dann haben es Leute mit kruden Verschwörungstheorien einfacher. Das bedient die Nachrichtenfaktoren. Polarisierendes, Polemisches und Provokatives wird gerne gedruckt, gesendet und geklickt. Wenige Akteure schaffen es durch krude Thesen immer wieder, eine hohe Aufmerksamkeit zu erzeugen, so dass der falsche Eindruck entsteht, dass hier eine Mehrheitsmeinung verbreitet wird.
Insgesamt brauchen wir zum einen eben Vielfalt. Aber wir brauchen auch Fehlereingeständnisse, wir müssen auch Fehler aushalten. Wenigstens in Ansätzen braucht der Journalismus dafür selbst eine Metaebene, um die eigene Arbeit selbstkritisch zu reflektieren. Einige Medien arbeiten daran schon, es gibt verstärkte Bürgerdialoge, die eigene Arbeit wird transparenter dargestellt, das führt auch zu Medienkompetenz bei den Rezipienten. Das kann der Journalismus allerdings nur sehr begrenzt leisten. Wenn ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin ein Forschungsprojekt bewilligt bekommt, sind ggf. zwei Jahre lang Zeit vorhanden, um Ergebnisse vorzulegen. Im Journalismus lässt der Redaktionsschluss derartige Zeiträume natürlich nicht zu.
Christian Schicha ist Professor für Medienethik am Institut für Theater- und Medienwissenschaft an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
Empfohlener redaktioneller Inhalt
Mit Ihrer Zustimmmung wird hier eine externe Buchempfehlung (Amazon Affiliates) geladen.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen (Amazon Affiliates) übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
