Nicht ihr Krieg: Stimmen aus Russland, der Ukraine und Belarus, die kaum gehört werden
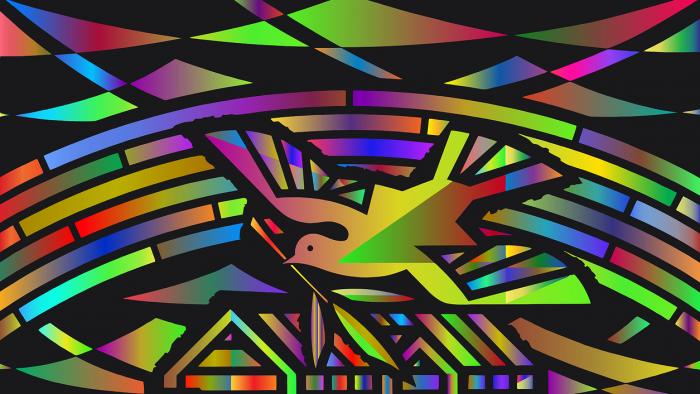
Internationalismus und Antimilitarismus scheinen momentan "out" zu sein. Wie etwa vor 108 Jahren. Symbolbild: Gordon Johnson auf Pixabay (Public Domain)
Pazifisten und Kriegsdienstgegner aus allen drei Ländern stellten sich in Berlin vor. Sie wollen nicht für steigende Aktienkurse sterben. So sehen ihre Chancen auf Asyl in Deutschland aus.
Leopard-Panzer, "Marder", Kampfjets, Abwehrwaffen, Drohnen, russische Überschallwaffen – 15 Monate nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine haben sich diese Vokabeln so in den Medien breitgemacht, dass wir es scheinbar gar nicht mehr merken.
Mit der Militarisierung der Sprache geht die Dehumanisierung einher, wenn eben die Gegner zu Ratten erklärt werden, die in die Mausefalle gekrochen sein sollen. Bis in den Kulturbereich geht die Militarisierung, wenn vor einem Hamburger Theater protestiert wird, weil dort das Stück eines desillusionierten russischen Ex-Soldaten aufgeführt wird.
Ja, es gibt auch Menschen in Russland, Belorussland und der Ukraine, die sich dem verweigern. Am Montagabend stellten sich diese Pazifisten in Berlin vor. Eingeladen wurden sie vom Netzwerk für die Rechte der Kriegs- und Militärdienstverweigerer, Connection e.V. am 15. Mai, dem Internationalen Tag der Kriegsdienstverweigerer. Schon am Vormittag hatten sie der EU-Kommission fast 50.000 Unterschriften für einen Aufruf übergeben, der Schutz und Asyl für Militär- und Kriegsdienstgegner fordert.
Von den Schwierigkeiten, Pazifist in einem kriegsführenden Land zu sein
Würde diese Rechte gesichert, hätte auch Yurii Sheliazhenko von der Ukrainischen Pazifistischen Bewegung direkt an der Veranstaltung teilnehmen können. Am Montag musste er online zugeschaltet werden, weil er, wie alle Männer zwischen 18 und 60 Jahren, wegen potentieller Wehrpflicht nicht aus der Ukraine ausreisen darf.
Sheliazhenko brachte in einfachen Worten seine Ablehnung des Militarismus auf beiden Seiten zum Ausdruck. Er ging auf die Opfer des russischen Militärs ein, aber auch auf die Zivilisten, die im Donbass mit ukrainischen Waffen getötet wurden. Er sprach von zwei militaristischen Mächten, die Krieg führen, für den Zivilisten die Zeche zahlen müssen.
Er sprach auch von den Schwierigkeiten, in einem kriegsführenden Land Pazifist zu sein. Einige der Gründungsmitglieder Ukrainischen Pazifistischen Bewegung wie Ruslan Kotsaba leben mittlerweile im Exil. Der christlich-konservative Pazifist war schon vor dem russischen Einmarsch in der Ukraine im Gefängnis und wurde zudem mehrmals von Ultranationalisten angegriffen.
Keine zweite Front
Mit solchen Angriffen sind auch Pazifisten in Russland und Belarus konfrontiert. Selbst Freunde und Verwandte können Opfer der Staatsorgane werden, daher wollte Maria von der Bewegung für Kriegsdienstverweigerung in Russland auch nur ihren Vornamen nennen, obwohl sie selbst schon im Exil lebt. Auch Olga Karach, die die liberale belorussische Oppositionsgruppe Nash Dom, was "Unser Haus" heißt, vertritt, lebt schon längere Zeit im Ausland.
In Belarus würde sie sofort verhaftet, wie alle Oppositionellen. Karach betont, dass ihre Organisation entschieden pazifistisch sei. Sie engagiert sich dagegen, dass Belarus direkt in den Krieg Russlands gegen die Ukraine einbezogen wird. Aber ihre Organisation lehnt es auch ab, auf Seiten der Ukraine in den Krieg zu ziehen, wie es einige belorussische Oppositionelle propagieren. Stattdessen ruft Nash Dom dazu auf, alles zu tun, um den Krieg auf beiden Seiten zu beenden.
Die Veranstaltung zeigte nicht nur, dass sich die aus völlig unterschiedlichen Kontexten kommenden Pazifisten verstehen, weil sie eben gegen jeden Militarismus und Nationalismus kämpfen. Sie zeigte auch, dass die Staaten, so verfeindet sie sind, ähnliche Methoden anwenden, um Menschen in den Krieg zu schicken.
Ähnliche Rekrutierungsmethoden der Staatsapparate
Dazu gehören elektronischen Möglichkeiten der Rekrutierung, die sowohl die russischen als auch die ukrainischen Staatsapparate nutzen. Damit sollen vor allem junge Menschen eingefangen werden, denn wenn die bestätigte Registrierung erst mal als Mail bei den betroffenen Menschen eingegangen ist, kann er oder sie auch eingezogen werden.
Diese elektronischen Rekrutierungsmethoden sind die Antwort auf die Weigerung vieler Menschen, staatliche Einberufungsdokumente in Papierform zu unterzeichnen. Sie waren einfach nicht erreichbar, haben nichts unterschrieben und so konnten sie nicht als Kanonenfutter für die unterschiedlichen Staatsinteressen dienen. Die meisten Menschen, die sich dem Militär- und Kriegsdienst verweigern, haben erst einmal sehr individuelle Gründe. Dazu gehört auch die Angst, im Krieg getötet zu werden.
Das aber ist kein Asylgrund in Deutschland, beschrieb Rudi Friedrich von Connection die aktuelle Praxis der Behörden. Das bedeutet, dass ein Mensch, der in Russland nicht in den Krieg ziehen will, weil er sein Leben nicht gefährden will, in Deutschland nicht als verfolgt anerkannt wird.
Sich dem Kriegsapparat zu entziehen, bevor man erst erfasst und eingezogen wird, ist für die Behörden in Deutschland kein Grund, den Betroffenen Schutz zu gewähren. Genau darauf zielt die Kampagne von Menschenrechtsgruppen und Pazifisten ab.
"Das ist nicht unser Krieg"
Das müsste eigentlich ein Anliegen sein, dass viel mehr als jene knapp 40 Menschen unterstützen, die sich am Montag in Berlin über die Positionen von ukrainischen, belorussischen und ukrainischen Pazifisten, Militär- und Kriegsdienstgegnern informiert haben.
Lieber verstricken sich viele Linke in so absurde Debatten wie jene darüber, ob etwa im Karl-Liebknecht-Haus, dem Sitz der Partei Die Linke in Berlin, künftig eine ukrainische Nationalfahne aus dem Fenster gehängt werden soll. Das wäre ein weiterer Schritt in Richtung SPD und ein totaler Bruch mit den antinationalistischen Positionen einer Rosa Luxemburg oder eines Karl Liebknecht.
Statt sich über solche Unterwerfungsgesten unter die Staatsräson zu zerstreiten, wäre eine gesellschaftliche Linke besser beraten, wenn sie Kriegsgegner und Pazifisten aller Länder unterstützen und über die historischen Hintergründe einer antimilitaristischen Tradition aufklären würde, wie sie mit den Konferenzen von Zimmerwald vor 108 Jahren aufgekommen sind.
Auch damals waren es zunächst die Stimmen weniger, die im Lärm der Waffen und der nationalistischen Parolen erst einmal kaum gehört wurden. In kurzer Zeit aber bekamen sie eine massive Unterstützung, vor allem von den Teilen der Arbeiterbewegung, die erkannt hatten, dass es nicht ihr Krieg war, in dem sie sterben sollten, während die Aktienkurse der Rüstungskonzerne in die Höhe schnellten.
Daran hat sich bis heute wenig geändert. Daher wäre es die Aufgabe einer gesellschaftlichen Linken, nicht den Nationalisten, sondern Pazifisten aus den osteuropäischen Ländern zuzuhören, sie zu unterstützen und mit dazu beizutragen, dass die Parole "Das ist nicht unser Krieg" unüberhörbar wird.
Der Autor ist am 22. Mai ab 20 Uhr Teilnehmer einer Diskussionsveranstaltung des Berliner Buchladens Schwarze Risse zum Thema Krieg und revolutionäre Perspektiven.