Relativierungen des Rechts
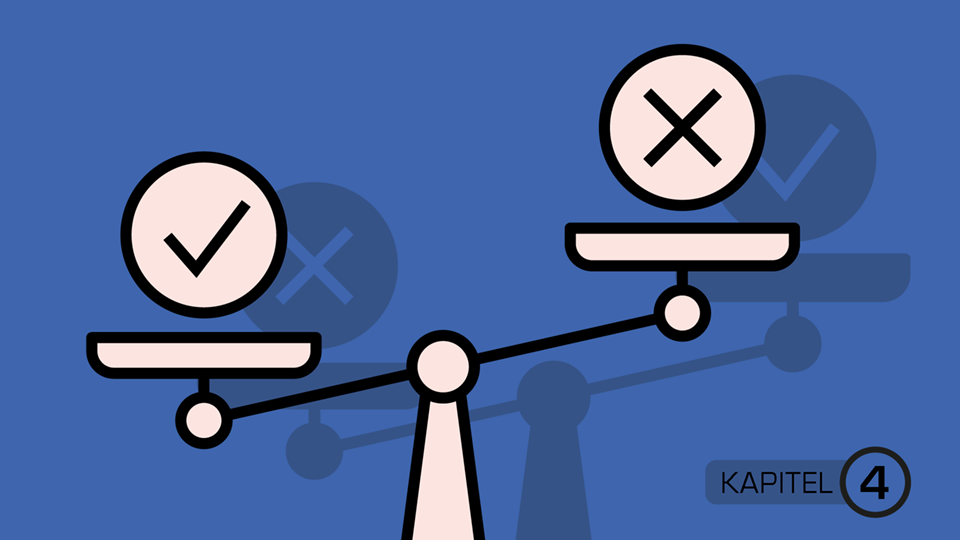
Recht und Moral in der Dissensgesellschaft - Kapitel 4
Kapitel 3: Minima Moralia
Der glückliche Selbstgerechte wird in spätmodernen Gesellschaften noch ganz anderen Nachstellungen ausgesetzt: Je größer und heterogener Gesellschaften sind, desto unwahrscheinlicher wird es, das komplexe Ideal der Konkordanz von gut handelndem Einzelnem und gerechter Gesellschaft einzulösen. Blaise Pascal spottete: "Man sieht fast nichts Gerechtes oder Ungerechtes, das nicht seine Verschaffenheit änderte, wenn es das Klima ändert. Drei Grade Polhöhe werfen die ganze Jurisprudenz über den Haufen."
Unsere Gesellschaften sind nicht erst seit der Flüchtlingskrise dadurch geprägt, dass zwar die nationale Rechtsordnung einheitlich ist, aber die Rechts- und Kulturkreise, aus denen Menschen kommen, verschieden sind und somit moralische Urteile in kollidierenden Wertordnungen gefunden werden müssen. Im Blick auf hohe Flüchtlingszahlen wird 2016 ein "Integrationsministerium" gefordert. Eine Administration von Werten und Moralen dürfte indes so wenig möglich sein wie die hoheitliche Ausformung eines integrationsfähigen Begriffs der Gerechtigkeit. Der Geltungsgrund einer gewachsenen Rechtsordnung, wenn es denn je einer gewesen ist, wird - selbst in der Rhetorik, die sich immer der Ethik beigesellt - fragil.
Der Rechtsphilosoph Norbert Hoerster erörtert die Frage nach dem Rechtsgehorsam an dem Beispiel eines Faulpelzes.1 Eine Jugendgruppe baut eine gemeinsam genutzte Berghütte und betreibt die durch die jeweiligen, als gleich vorausgesetzten Leistungen der einzelnen Mitglieder. Dieses Szenario aufgreifend sei "Oblomow" ein Faulpelz, der nichts tut, aber gleichwohl die Einrichtung nutzt. Das fällt nicht weiter auf, weil die Gruppe über hundert Mitglieder hat, sodass es "unter dem Strich" unerheblich ist, ob der Faule faul bleibt oder seinen Beitrag leistet.
Das typische Argument, was wäre, wenn alle so handeln würden, reicht zur Begründung moralischen Verhaltens nicht aus. Denn diese Frage verändert die "Versuchsanordnung" und verschiebt vor allem die Frage des subjektiven Moralbewusstseins auf eine Kollektiventscheidung, die sozialpsychologisch anders konstruiert wäre. Man kann diesen Fall leicht so beschreiben, dass die anderen Mitglieder der Jugendgruppe in jedem Fall ihren (gleichen) Beitrag erbringen. Gibt es jetzt für unseren moralischen Problemfall einen Grund, dem gemeinsamen Plan zu entsprechen? Wer sich ohne Grund dispensiere, eröffne damit auch anderen diese Option. Verlangt die Gerechtigkeit, dass Oblomow die Leistung, die er bei anderen voraussetzt, auch selbst erbringt?
Diese Reziprozität ist auch in hässlicheren Varianten bekannt, etwa in dem Spruch "Wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen". Nicht erst der Sozialstaat hat diese Denkweise desavouiert. So oder ähnlich, mit mehr oder weniger starken Anleihen an die goldene Regel, den kategorischen Imperativ, an primäre Gleichheit oder das Gleichheitsgefühl laufen die meisten moralischen Begründungsmuster ab, die indes immer zu demselben (gewünschten) Resultat führen. Es ist gut und richtig, gut und richtig zu handeln.
Das Beispiel des unsolidarischen Faulpelzes lässt sich völlig anders moralisch auflösen. Denn Oblomow könnte, ohne unserer Ausgangskonstellation Gewalt anzutun, argumentieren, dass er von anderen überhaupt keinen Beitrag erwarte. Neigt Oblomow zu einem eher milden Zynismus, könnte er sagen, dass er zwar einen Beitrag der anderen erwarte, aber weniger aus moralischen Gründen als aus Herdeninstinkten oder Gemeinschaftsgefühlen, die er weder empfindet noch erwidern möchte. Oblomow könnte auch wollen, dass sein Verhalten nicht zur allgemeinen Maxime würde, weil er dann ja nicht mehr (ohne Gegenleistung) von den anderen profitieren würde.
Oblomow ist nicht nur in der Berghütte, sondern vor allem in der Moraltheorie ein Spielverderber. Die Geschichte der Ethik ist der immer währende Versuch, Figuren wie Oblomow zu diskreditieren, so sicher Oblomow immer existierte und kaum je moralisch argumentativ zu überzeugen war. Es ist leicht zu erkennen, dass Oblomow, wenn er einen klaren Willen zu Faulheit, Unsolidarität und "Parasitismus" hat, eher nicht mit Gründen überzeugt werden kann, die er nicht bereits kennt.
Richard Rorty hält die Fixierung auf den "Psychopathen" für einen fatalen Irrtum der Moraltheorie, die sich stattdessen um einen sehr viel relevanteren Typus moralischer Urteilsbildungen kümmern solle. Das eigentliche Problem sei die Identitätsbildung moralischer Gruppen. Innerhalb der Gruppe folgen sie moralischen Regeln, die aber keine Anwendung finden können, wenn sie sich auf Nichtzugehörige - Frauen, Afroamerikaner, Juden, Ungläubige etc. - beziehen. Diese Grenzen seien aber nicht durch "Vernunft" zu überwinden, sondern durch die "Schule der Empfindsamkeit", um das Mitgefühl auf das Niveau zu bringen, die Zugehörigkeit zu einer biologischen Spezies auch zum Merkmal einer moralischen Gemeinschaft zu machen.
Zurück zu Oblomow. Eine aufgeklärte Ethik wird Oblomow nicht bekehren wollen, denn selbst, wenn es eine moralische Logik gäbe, ähnlich dem artifiziell arrangierten Gefangenendilemma, aus dem heraus nur das reziproke Handeln vorteilhaft wäre, könnte Oblomow obstinat im persönlichen Irrtum verharren. Ist es unmoralisch, sich dumm zu stellen gegenüber den Anmutungen einer moralistisch stringenten Logik?
Selbst wenn der kategorische Imperativ oder vergleichbare Formeln "richtig" wären und selbst wenn sich Oblomow dem in der Theorie anschließt, können wir Oblomow nicht zwingen, dieser abstrakten Richtigkeit zu folgen. Woody Allen: "Wie Du dir, so ich mir." Ist Moral der Politik darin verwandt, auch anders handeln zu können - wenn es opportun erscheint? Das Problem wird nicht dadurch relativiert, dass das Recht seine eigene Durchsetzung nicht von der Reflexion der Unterworfenen abhängig macht, weil genau dieses Moment den wesentlichen Unterschied zur Moral begründet. Wer nicht aus Einsicht rechtsgehorsam reagiert, wird im Zwangssystem des Rechts viele Wege finden, seine Nichtüberzeugung zu leben.
Die Krise zieht in Rechtssysteme ein, wenn Oblomow also so argumentiert: Mein Verhalten mag falsch und minderwertig sein, aber entweder habe ich Gründe dafür gehabt oder es gibt Gründe, die ich nicht kenne oder aber ich bin indifferent gegenüber der Begründungsfrage. Mit anderen Worten: Oblomow wird das System genauso wie ein moralisch konstituiertes zu nutzen wissen, um seine Ziele zu verwirklichen.
Weil Ethiker Oblomow und seine Brüder gut kennen, sind einige von ihnen bereit, den absoluten Begründungsduktus für moralische Regeln aufzugeben. Harold Arthur Prichard stellte die Kardinalfrage, ob die Moralphilosophie nicht auf einem Irrtum beruht. Wir kämen nicht durch eine Argumentation zur Erkenntnis einer Verpflichtung, sondern durch das Gefühl der Verpflichtung. Hätte Prichard Recht, wäre es sinnlos, mit amoralischen Figuren wie Oblomow argumentativ zu streiten, weil Emotionen in einem Diskurs keinen Geltungsanspruch besitzen. Prichards viel erörterter Zwischenruf markiert die Differenz zwischen der Reflexion und einem situationsbezogenen Akt des moralischen Denkens. Was nutzen uns eine prästabilierte Harmonie der theoretischen Moral, kategorische Imperative oder Diskursethiken, die in der Stunde ihrer Bewährung unzuverlässig sind?
"Die Freiheit nehm' ich mir"
Spätestens seit Michel de Montaigne (1533 - 1592) und Thomas Hobbes (1588 -1679) wird der ethische Universalismus zur drängenden Frage, weil die vernunftgemäße Selbstreflektion der Moral neue Herausforderungen einer global vernetzten Welt verarbeiten muss. Vormals gesicherte Repräsentationen der Macht verändern sich nachhaltig. Kurzum: Gibt es allgemeinverbindliche Regeln für alle Menschen? Welche Autorität ist der Rechtsgrund für mein Handeln?
Als der Chevalier de Bouteville 1766 einem Genfer Bürger erklärte, dass seine besondere Autorität darauf zurückzuführen sei, dass er Vertreter des Königs sei, erwiderte dieser auf das Traditionsargument: "Und ich bin Repräsentant von meinesgleichen." Repräsentationen verlieren immer stärker ihre legitimatorischen Urgründe, wenn permanent neue Identitäten ihre irreduziblen Eigenarten einfordern. In einer Zeit des Geschlechterbebens und immer individuellerer Selbstkonzeptionen weicht "der Mensch" der Menschenrechte partikularistischen Identitäten, die universale Regeln als Quelle der Ungerechtigkeit denunzieren.
In Harrisburg im Bundesstaat Pennsylvania wurde im Jahr 2016 die Schülerin Aniya Wolf nicht zum Abschlussball der katholischen Bishop McDevitt High School zugelassen, weil sie einen Smoking tragen wollte. Wer den eher komplexen Dresscode der Schule verletzt, muss dort, nach der Drohung der Schulleiterin und Ordensfrau ("Immaculate Heart of Mary") zu schließen, mit dem Polizeieinsatz rechnen. Die MitschülerInnen riefen dazu auf, an einem Tag alle mit Hosen zur Schule zu kommen, um die Unbeflecktheit der schulischen Sitten zu provozieren. Der Schulleiter der William Penn High School in York (Pennsylvania) hatte kein Problem, der Schülerin im Tuxedo Einlass zu gewähren. Man begrüße jeden.
Andererseits liegen Erkenntnisse vor, dass die Unifizierung von Lebensverhältnissen jenseits geschlechtsspezifischer Differenzierungen zu Freiheitsgewinnen führen kann. In der norwegischen Armee wird erfolgreich mit Unisex-Schlafräumen experimentiert. Seitdem männliche und weibliche Soldaten gemeinsam untergebracht werden, ist dort von sexueller Belästigung nichts mehr zu hören (Gleichberechtigung durch Wehrpflicht). "Degenderization" wird zum Stichwort gegen vormalige Geschlechtsordnungen, gegenüber denen der Verdacht immer lauter wurde, dass patriarchalische Machtausübung und die strikte Trennung der Geschlechter in einem Bedingungszusammenhang stehen.
Autoritäten stehen seit langem unter Rechtfertigungsdruck. Die Geschichte der Neuzeit präsentiert zahlreichen Demontagen unhinterfragter Autorität. Nach einigen Jahrhunderten antiautoritären Trainings, mit den vorläufigen Höhepunkten der französischen Revolution bis hin zur linken Justizkritik wider das "Establishment", Robin Wood, Greenpeace oder "Fridays for Future" erweist es sich, dass die Chancen antiautoritärer Praxis, sich als neue Autorität über die Autorität des Staates hinwegzusetzen, beachtlich sein können.
Die Anti-AKW-Bewegung und zuvor die APO waren nicht nur Widerstandsformen mit präzise bis wolkig konturierten Inhalten, sondern produktive Lernformen politischer Auseinandersetzung mit dem Staat. Wer allein ihre Bekämpfung für die Sache des Staates hält, verkennt, dass der Staat sich erst durch historische Widerstandsformen so "justieren" konnte, dass er über seine Kritik den Geltungsgrund für seine demokratische Façon findet. Der Staat hat wie diese Gruppen gelernt, jedenfalls in ihrer Abkehr von bestimmten Gewaltformen, dass er elastisch bis einsichtsvoll mit Machtphantasien und Autoritätsgesten der Gesellschaft umgehen muss, wenn er nicht seine eigene Abdankung einleiten will. Aber wo liegen die Grenzen einer selbstbestimmten Freiheit?
Am 6. März 1981 betritt Marianne Bachmeier einen Sitzungssaal des Landgerichts Lübeck. Sie zückt eine Beretta M1934 und schießt auf den Angeklagten Klaus Grabowski acht Mal. Der mutmaßliche Mörder ihrer siebenjährigen Tochter stirbt unmittelbar darauf. Zunächst behauptet sie in dem gegen sie gerichteten Verfahren, sie habe im Affekt gehandelt. Plausibel ist das nicht, von den acht Schüssen treffen immerhin sechs. Später kommt heraus, dass sie das Hinrichtungsszenario gut vorbereitet hatte. Marianne Bachmeier konzediert, dass sie Selbstjustiz verüben und verhindern wollte, dass der Angeklagte weiter Lügen über ihre Tochter verbreiten könne.
Vermutlich war es der erste, jedenfalls der spektakulärste Fall von Selbstjustiz in einem bundesrepublikanischen Gerichtssaal. Viele Bürger waren der Auffassung, dass die Tat gerechtfertigt, ja mehr: die einzige angemessene Reaktion auf ein abscheuliches Verbrechen war. Staatsanwälte und Richter wurden anonym für den Fall bedroht, dass sie die Täterin verfolgten bzw. verurteilten. Im Fall der Bachmeier geht es nicht um eine Selbstjustiz, die subsidiär zum Zuge kommt, weil die staatliche Justiz versagt. Der mutmaßliche Täter war angeklagt und eine Bestrafung nicht unwahrscheinlich. Warum wird gleichwohl von nicht wenigen Menschen Selbstjustiz für die bessere Lösung gehalten?
Marianne Bachmeier bekam in der Haft körbeweise Post und erhielt nicht unerhebliche Geldspenden. Die Unmittelbarkeit der (biblischen) Rache verschafft Tätern und Beobachtern eine Genugtuung, die die staatliche Justiz nicht zu gewähren vermag. Die korrektive Gerechtigkeit hat einen atavistischen Urgrund, die noch jede Strafzwecktheorie bestimmt, die von Vergeltung, von der Anerkennung des Straftäters durch die Strafe, von der rechten "Bemessung" der Strafe spricht.
Kurzer Prozess
Das Unbehagen an einem kodifizierten Rechtssystem, dessen Autorität sich in den Irrungen und Wirrungen des Prozesses verliert, findet sich an vielen gesellschaftlichen Orten. Am 03.12.1792 hält der Jurist und Revolutionär Robespierre, den sie den "Unbestechlichen" nennen, vor dem Nationalkonvent eine bemerkenswerte Rede, die sich mit der Frage befasst, ob man gegen den König einen Prozess führen solle. Zeitgenossen fragten sich nach der Entdeckung diverser Schriftstücke aus dem "Eisenschrank", ob der König des Verrates an nationalen Interessen schuldig sei. Robespierre setzt anders an.
Als Jurist und Advokat weiß er, dass der gerichtliche Disput nicht das im öffentlichen Interesse gewünschte Ergebnis produzieren könnte. Ein Prozess gegen den König ist so wenig oder noch weniger antizipierbar wie irgendein Prozess. Vor allem aber ist für den Revolutionär die Vorstellung unerträglich, dass die Unschuldsvermutung gilt und "horribile dictu" der Monarch freigesprochen werden könnte. Robespierre stellt fest, dass der König aufgrund seiner Verbrechen nicht gerichtet werden könne, weil er "bereits verurteilt" sei. Wer dagegen einen Prozess fordere, mache der Revolution selbst den Prozess. Robespierre unterscheidet sodann die revolutionäre Situation von einer gefestigten Regierung, die sich solche aufwändigen Verfahren wie Prozesse leisten könne.
In der Folge seiner Rede versucht der Anwalt Robespierre deutlich zu machen, dass es der größte Fehler wäre zu glauben, die Gerechtigkeit würde verfehlt, nur weil es keinen Richter, kein Tribunal und keine Prozessordnung gäbe. Robespierre macht auf den Spuren Rousseaus klar, dass hier keine Urteile gefällt werden können, weil die Nation in den "Naturzustand" gegenüber dem Tyrannen eintritt. Der Gesellschaftsvertrag sei verletzt worden und damit hinfällig.
In unserer Gegenwart werden Befriedigungs- und Befriedungsdefizite des Rechts in fiktionalen Welten schneidig gelöst. Die allfälligen "Bösen" werden in PC-Spielen, Filmen und Romanen mit mehr oder weniger großem Aufwand regelmäßig zur Strecke gebracht. Vielleicht gilt die Regel: Je differenzierter Regeln und Gesetze gesellschaftliche Lebenswelten erfassen, desto stärker wird die Appetenz nach fiktiven Formen simplizistischer Konfliktbewältigung. Hierfür stehen Figuren wie "Jugde Dredd", der als Polizist, Richter und Vollstreckungsorgan in einer Person Erkenntnisverfahren und Vollstreckung kurzschließen darf, sodass das Fahrzeug eines Verkehrssünders noch gleich am Tatort vernichtet wird.
Solche Primärfantasien prädemokratischer bzw. neofaschistischer Justiz sind anderenorts Autofahrern vorbehalten, die im Straßenverkehr ihre Rechte beeinträchtigt sehen. Und davon gibt es einige. Das weite Feld medial inszenierter Gerechtigkeit wird in explosiven Kollisionen des Rechts mit der Moral entfacht. Die Aussagen variieren: Das Recht taugt nichts, es wird zu lasch angewandt, es gibt eine vorrangige Moral oder das Recht ist ganz abhandengekommen. Die Selbstjustiz der Schwarzeneggers, Stallones und der Helden von DC bis Marvel sind Siege der moralisch bereits entschiedenen Fragern, der klar definierten Helden über die juridischen Anmutungen einer ausdifferenzierten Gesellschaft, der die Ausbildung eines gemeinsamen Wertekanons immer schwerer fällt.
"Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann." Dieses berühmte Diktum Böckenfördes bezeichnet die Abhängigkeit von außerjuristischen Werten und Einstellungen, die unabdingbar sind, das Rechtssystem am Leben zu erhalten. Ohne "junge demokratiefähige Bürger" (Paul Kirchhof) wird ein System gefährdet, die Ansprüche an Recht und Gerechtigkeit zu realisieren. Doch populistische Tendenzen, die immer stärker westliche Gesellschaften erfassen, demonstrieren die Fragilität des Vertrauens auf diesen "homonculus" einer gerechten Demokratie.
Ist Gerechtigkeit nur eine illusionäre Überformung der Macht des Faktischen? Bricht die Gewalt das Recht, wenn der Staat schwach wird? Schon Solon, 640 v. Chr. in Athen geboren, hielt zwar das Recht für heilig, soll aber sehr pragmatisch eine immergrüne Vermutung der Justizkritiker so formuliert haben: "Die Gerechtigkeit ist wie ein Spinnennetz. Es hält die kleinen Insekten gefangen, die großen aber zerreißen es und kommen frei." Diese Botschaft wurde auch anderenorts sehr viel später mit eben dieser Metapher erfasst: "Die Gesetze sind den Spinnweben gleich, da die kleinen Fliegen und Mücken innen bleiben henken, die Wespen aber und Hornissen hindurchdringen", beobachtete 1662 Christoph Lehmann im "Florilegium Politicum" (Politischer Blumengarten).
Kohlhaas, der du dich gesandt zu sein vorgibst, das Schwert der Gerechtigkeit zu handhaben, was unterfängst du dich, Vermessener, im Wahnsinn stockblinder Leidenschaft, du, den Ungerechtigkeit selbst, vom Wirbel bis zur Sohle erfüllt? Weil der Landesherr dir, dem du untertan bist, dein Recht verweigert hat, dein Recht in dem Streit um ein nichtiges Gut, erhebst du dich, Heilloser, mit Feuer und Schwert, und brichst, wie der Wolf der Wüste, in die friedliche Gemeinheit, die er beschirmt.
Michael Kohlhaas sieht die Dinge völlig anders als die Gesellschaft, die nicht sein Interesse ausblendet, aber eben in einen globalen Kontext stellt, der dieses Unrecht jedenfalls nicht für ausreichend hält, die Justiz selbst in die Hand zu nehmen. Kohlhaas' Selbstjustiz ist der explosive Gegenentwurf, der den Mangel an Gerechtigkeit zum herausragenden Impuls stilisiert, die Suche nach der wahren Gerechtigkeit nicht aufzugeben. Die Gerechtigkeit führt sich selbst vor, entzweit sich und erfüllt darin ihr Wesen, Verhältnisse antagonistisch zu gestalten.
Solche Figuren sind literarisch und medial gut repräsentiert, weil Rächer a la Zorro die Bedingtheiten des staatlichen Gewaltmonopols drastisch vor Augen führen. Und in unseren neuen "super-diverse cities" mit den verschiedenartigsten Hintergrundgerechtigkeiten, die auf die Praxis und das Verständnis des Rechtsstaats einwirken, nimmt die Nachkommenschaft von Michael Kohlhaas zu. Der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, erklärt im Interview auf Welt online im April 2010:
Es gibt Straßenzüge in manchen Vierteln Berlins, Hamburgs, Duisburgs, Essens oder Kölns, in die sich Polizisten nicht mehr alleine hineintrauen. Wenn dort ein Beamter einen Autofahrer wegen überhöhtem Tempo kontrolliert, hat der blitzschnell 40 bis 70 Freunde herbeitelefoniert. Und wird der Beamte erst von so einer Menge bedrängt und beschimpft, muss der Rechtsstaat leider kapitulieren und sich zurückziehen.
Nach Wendts Auffassung akzeptieren die Täter mit türkischem oder arabischem Hintergrund die deutsche Rechtsordnung nicht. In diesen städtischen Vierteln sei das staatliche Gewaltmonopol in Gefahr. Die Akteure würden den Ordnungskräften mitteilen, dass sie die Konflikte selbst regeln wollten, das sei mit dem "Hodscha, nicht mit euch" zu regeln. Selbstjustiz wird zum brisanten Thema, wenn die Rechtsordnung nicht ein Recht für alle herstellt, sondern in Gesellschaften Enklaven entstehen, in denen andere Regeln gelten.
Das ist kein exklusives Problem ethnischer oder religiöser Verschiedenheit wie das organisierte Verbrechen in zahlreichen Ländern zeigt. Die Mafia in Italien oder die traditionsreiche, regelintensiv organisierte Yakuza in Japan sind seit je nicht nur Anfechtungen staatlicher Autorität und Hoheit, sondern Gruppen mit eigener Justiz, die nicht dem Staat überlassen, was sie selbst regeln wollen.
It is to Madame Justice that I dedicate this concerto, in honor of the holiday that she seems to have taken from these parts, and in recognition of the impostor that stands in her stead.
So spricht "V" der Racheengel einer überfälligen Gerechtigkeit in dem Kultfilm "Vendetta" aus dem Jahre 2005. "V" leitet eine Ein-Mann-Revolution gegen die britische Diktatur einer dystopischen Zukunft gerechtigkeitsdramaturgisch so voll überzeugend ein, dass seine Guy-Fawkes-Maske zum Wahrzeichen von "Anonymous" wurde. Während "V" seiner späteren Gefolgsfrau Evy die ungerechten Verhältnisse erklärt, sprengt er die große goldene Statue der Justiz auf "Old Bailey" zu den Klängen einer Freiheitsmusik in die Luft.
Der Gerechtigkeitshorizont in "Vendetta" spannt sich über die Jahrhunderte. Guy Fawkes, der berühmte Rebell des "Gunpowder Plot" von 1605 avanciert in der 1841 verfassten Geschichte von William Harrison Ainsworth zum antiautoritären Helden auf Gedeih und Verderb. Wenn "Anonymous" gegenwärtig die Maske von "V" im politischen Kampf einsetzt, wird die Gerechtigkeit vorinstalliert. Jeder Maskenmann und jede Maskenfrau sind a priori die Helden einer antistaatlichen Gerechtigkeit, die von der Selbstgerechtigkeit der staatlichen Insignienkultur inszenatorisch und rhetorisch gelernt hat:
We are Anonymous.
We are Legion.
We do not forgive.
We do not forget.
Expect us.
Die erfolgreichen Filme von Quentin Tarantino oder Robert Rodriguez leben von der Abwesenheit des Rechts, das sie gegen ihr eigenes hypermoralisches Regelsystem austauschen. In dieser Welt krimineller Privatheit wäre es grotesk, staatliche Kräfte in Anspruch zu nehmen. Der moralische Genuss des überlasteten Zeitgenossen besteht darin zu sehen, wie die Komplexität der uns geläufigen Verhältnisse in dieser klaren Luft des Verbrechens weggefegt wird.
Der Gelegenheitskriminelle Pumpkin überfällt mit seiner Freundin "Honey Bunny" ein Schnellimbiss-Restaurant und raubt die Gäste aus. Unter den Opfern ist - wie es der Zufall in Tarantino-Filmen oft will - der Profikiller Jules, der sich berauben lässt und Pumpkin plötzlich mit vorgehaltener Pistole erklärt, dass er ihn leicht hätte erschießen können, wie es seiner üblichen Art entspräche. Er wäre aber ein Mann der Religion geworden und deshalb dürfe Pumpkin sein Geld behalten. Allein die Brieftasche mit dem Aufdruck "Bad Motherfucker", an der sein Herz hänge, möge er herausgeben. In diesem Moment erscheint Jules' Kollege Vincent, dessen kategorischer Imperativ mit dem Konvertiten Jules und der von ihm angerichteten moralisch unsauberen Situation nicht klarkommt: "Jules, if you give that fuckin' nimrod fifteen hundred dollars, I'm gonna shoot him on general principles."
Vincent Vega ist ein (böser) Kantianer und seine allgemeinen Maximen kennen keine Ausnahme: Wer den Clan bestiehlt, ist dem Tode geweiht. Jules gelingt es mit Mühe, den prinzipientreuen Vega von seinen moralisch tödlichen Reflexen abzuhalten. In höchster Gefahr siegt die einfühlsame Gewissensanspannung gegenüber den Anmutungen einer Moral der Maximen. Der ständig von Jules als Leitmotiv zitierte, von ihm leicht verballhornte Bibelspruch, den er, wie er selbst einräumt, nicht ganz verstanden hat, macht nun endlich einen Sinn: "Der Pfad der Gerechten ist zu beiden Seiten gesäumt mit Freveleien der Selbstsüchtigen und der Tyrannei böser Männer." In dieser Welt der kategorischen Maximen und kollektiv definierter Interessen ist der Pfad des Gerechten nicht leicht zu gehen.
Internationales "law enforcement" im hilflosen Wirrwarr von nationalen Zuständigkeiten verdankt sich oftmals riskanten privaten Initiativen, die Ländergrenzen überschreiten wie Simon Wiesenthal oder Beate und Sergej Klarsfeld. Wo die Staatengemeinschaft, die längst keine Gemeinschaft ist, nicht handelt, sind Einzelne aufgerufen. Aber wer bestimmt das Verhältnis von Willkür und einer internationalen Gerechtigkeit, die nicht zuverlässig auf die Entscheidungsgewalt internationaler Institutionen bauen kann? Querulanten, Verräter, Whistleblower oder Gerechtigkeitsfanatiker sind in den Medienspiralen nicht jederzeit gut zu unterscheiden. Je desintegrierter Gesellschaften und je divergenter Lebenskonzepte mit höchst verschiedenen Traditionen sind, bei im Übrigen geringen Rationalitäts- bzw. Reflexionsbereitschaft, desto mehr häufen sich Fälle von Selbstjustiz.
Ehrenmorde sind ein Beispiel, dass Gerechtigkeitsvorstellungen so sehr divergieren, dass der Staat nicht mehr als angemessenes Instrument des Rechts erscheint. Solche Taten sind in der Perspektive des Täters keine Straftaten. Selbst der Terror ist, ungeachtet seiner dunklen Motivationen, auch eine Art der fundamentalistischen Rechtskritik, weil der Terrorist die instrumentelle Verschiebung vom Recht zur Gewalt gerade für sein Recht hält. Insofern beobachten wir, modisch formuliert, ein "re-entry": Die Gewalt, die sich über das Recht stellt, legitimiert sich in ihrer eigenen Rechtslogik und ist daher regelmäßig nicht als bloße Gewalt polit-rhetorisch zu erledigen. Was zunächst als Störung definiert wird, kann später als Anstoß, Katalysator oder selbst als Funktion beschrieben werden, was einfache Zuordnungen, das Recht dem Unrecht oder die Ordnung der Unordnung vorziehen, unzulänglich macht. Moralische Impulse, die eine Mehrheit der Gesellschaft verwirft, können für die Entwicklung einer Gesellschaft herausragend sein.
Ein moralisch antiquiertes Institut wie die tätliche Wiederherstellung der familiären "Ehre" durch die Tötung eines Menschen verliert dagegen seine vormalige gesellschaftliche Anerkennung und mutiert zum "Mord". In der Gleichzeitigkeit des moralisch Ungleichzeitigen stoßen die Wertewelten heterogen strukturierter Gesellschaften aufeinander. "Er wollte die Tat bewusst spektakulär inszenieren, um seine Ehre wieder herzustellen", erläuterte das Landgericht Stuttgart, als es einen Täter im Dezember 2007 zu "lebenslänglich" verurteilte, der seine Ehefrau auf dem Flughafen erschossen hatte. Die Tat stellt sich als Akt der (Selbst)Gerechtigkeit dar, weil der Täter nicht lediglich auf Rache sinnt, sondern das tut, was die Strafjustiz nicht gewährleisten kann. Es ist eine Ironie, dass dieses Gerechtigkeitsdefizit der hiesigen Strafjustiz dann dazu führt, dass der Täter wiederum von dieser verurteilt wird, während er doch glaubt, deren vernachlässigte Aufgabe erst wahrhaft gerecht zu erfüllen.
Der exkommunizierte Geistliche Paul Jennings Hill wurde in den USA am 3.September 2003 hingerichtet, weil er den Arzt John Britton, der Abtreibungen durchführte, und dessen Mitarbeiter getötet hatte. Vor Gericht erklärte Hill, er empfinde keinerlei Reue, sondern gehe davon aus, eine große Belohnung im Himmel zu erhalten. Das ist das transkonfessionelle Wissen aller Fundamentalisten, die ihren göttlichen Sendbotenstatus unter Beweis stellen. Hill erläuterte, dass er nicht Vergeltung üben, sondern ungeborenes Leben schützen wollte. Dieser Tätertypus ist von der Integrität seiner Motive so stark erfüllt, dass ihn täterbezogene Strafzwecke der weltlichen Gerechtigkeit wie Resozialisierung oder Besserung nicht mehr erreichen.
Richard Dawkins nimmt das als Beispiel für den fatalen Einfluss der Religion auf Menschen. Dogmatische Systeme vermitteln ihren Protagonisten Sicherheit und Unangreifbarkeit. Gerade die tiefenpsychologisch beobachteten Schwächen und Unsicherheiten der Apologeten führen nicht dazu, dass sich die Fragilität solcher Meinungen auch in Handlungsschwächen äußert. Religiöse Terroristen und Überzeugungstäter aus dem radikalen politischen Spektrum schotten ihre Moral autistisch gegen Kritik ab und werden darüber zu lebenden Waffen. "Es scheint so zu sein, dass die aktive Teilnahme an einem Terrorsystem so viel an psychischer Gratifikation mit sich bringt, dass das Risiko, zu seinem Opfer zu werden, wesentlich geringer wiegt."2 Hill berief sich auf die "Army Of God", eine militant-rechtsradikale Gruppe, die für die meisten Angriffe auf Kliniken in den USA, die Abtreibungen durchführen, verantwortlich ist.
Jeanne d’Arc sah das für ihre Mission nicht viel anders: "Meine Worte und Werke habe ich auf Gottes Geheiß vollbracht. Ich lege sie niemandem zur Last: weder dem König noch einem anderen; und wenn daran ein Falsch ist, so fällt es auf mich und niemand anderen zurück." Im Klartext soll das den Anklägern und Richtern sagen, dass ihre Verurteilung einem (blasphemischen) Verdikt gegenüber Gott selbst gleichkäme. Schon zuvor hat sie dieses Argument eingesetzt, dass allein Gott darüber zu befinden habe, ob ihr Verhalten eine Todsünde darstellt.
Prozessual betrachtet handelt es sich um eine Zuständigkeitsrüge. Die Aussagen sind rhetorischer Natur, was unter den damaligen Umständen einer politisch beeinflussten Justiz mit rabulistisch agierenden Richtern keinen Vorwurf begründet. Insofern verwandelt sich die Übernahme der persönlichen Verantwortung umstandslos zu einer Freizeichnung von jeder Schuld. Sokrates hatte dieses Schema in die europäische Prozessordnung als eine überzeitliche Konstante eingeführt. Sokrates wehrte sich gegen den Vorwurf der Gottlosigkeit mit dem Verweis auf den Auftrag des Apollon. Sein "Daimonion" würde ihn warnen, sodass er richtiges und falsches Handeln unterscheiden könne. Was vermag der menschliche Richter gegen Gottheiten, die im Fall des "Daimonion" bereits eine interne Kontrollinstanz wie das Gewissen aufrufen?
Sokrates hätte vielleicht argumentative und rhetorische Autorität genug besessen, seine Verteidigung ohne Berufung auf höhere Instanzen zu realisieren. Doch Jeanne d’Arc blieb nichts anderes übrig als ihren Prozessstatus in divinen Bezügen zu nobilitieren. Die Erklärung eines einfachen Mädchens aus dem Volke hätte keinerlei Autorität besessen. Und wenn die Sendbotin Gottes in der kurzen Zeit ihres rasanten Aufstiegs und Falls etwas gelernt hatte, dann war es der Umgang mit Autoritäten, die nur zu beeinflussen waren, wenn noch höhere Autoritäten im Spiel waren.
Posthum hat Jeanne d'Arc ihren Prozess gewonnen. 1450 setzen die Bemühungen ein, das Verfahren wiederaufzunehmen. 1456 wurde das Urteil aufgehoben. Hintergrund war, dass Karl VII. seine Legitimation nicht dadurch gefährden wollte, seinen Thron einer Teufelsbeschwörerin und letztlich ihrem Herrn, Satan höchstselbst, zu verdanken.
Ob Jeanne d'Arc je mehr war als ein Instrument der Macht, eine "Auserwählte", die in Wirklichkeit den Mächten jener Tage zur rechten Zeit am rechten Ort erschien, mag verschieden deutbar sein. Fraglos besaß ihre "göttliche Sendung" aber die vorzügliche Eignung, politisch besetzt zu werden. Insofern war ihre göttliche Bevollmächtigung, die heute womöglich als paranoide Schizophrenie in der Psychiatrie geendet wäre, kein Bruch mit der politischen oder menschlichen Ordnung, sondern deren Bestätigung.
Kapitel 4: Der müde Leviathan
