Unter der Herrschaft einer Form der milden Funktionärsdiktatur
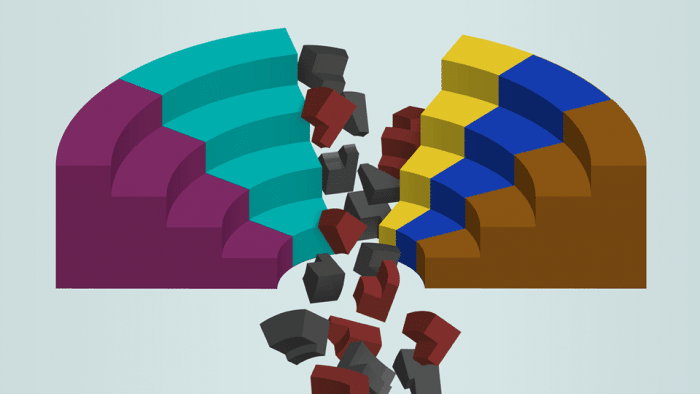
Der Niedergang der klassischen Volksparteien ist unaufhaltsam - Teil 2
Die soziale Struktur aller Volksparteien unterscheidet sich in allen Ländern drastisch von der der wahlberechtigten Bevölkerung. Zwischen den Volksparteien und dem Volk liegen Welten. Da gibt es kaum Gemeinsamkeiten oder Ähnlichkeiten.
Parteimitglieder haben eine überdurchschnittlich hohe formale Bildung und arbeiten zu einem wesentlich höheren Anteil als der Bevölkerungsschnitt im öffentlichen Dienst. Krass unterrepräsentiert sind jüngere Leute im Alter von 18 bis 40 Jahren und Frauen. Während sich nur 8 Prozent der Wahlberechtigten der oberen Mittelschicht oder der Oberschicht zurechnen, tun das 30 Prozent der Mitglieder aller politischen Parteien.1
Nach der Berufsstruktur ihrer Mitglieder haben sich die Parteien im Laufe der Jahrzehnte zunehmend aneinander angeglichen: Die SPD ist keine Arbeiterpartei mehr, die CDU/CSU keine Partei von Unternehmern und Landwirten und die FDP nicht mehr die Partei des alten und auch nicht des neuen Mittelstands. Alle versuchen, auf möglichst breiter Basis die Mitte für sich zu gewinnen.
Das Dilemma einer politischen Missgeburt. Der Niedergang der klassischen Volksparteien ist unaufhaltsam - Teil 1
Im Laufe der 1950er, 1960er und 1970er Jahre haben sich die politischen Parteien radikal verändert. Beherrschte davor noch der Gegensatz zwischen Arbeiterparteien und bürgerlichen Parteien die politische Landschaft, so haben sich alle Parteien seither in der Struktur ihrer Mitglieder stark angeglichen: Sie sind ein Spiegel der "nivellierten Mittelstandsgesellschaft" (Helmut Schelsky) geworden und haben sich von ihren traditionellen sozialen Milieus losgelöst. Unter den Mitgliedern aller Parteien dominieren nun Beamte, öffentliche Angestellte und Rentner.2
Eine Schieflage besteht auch in der Alterszusammensetzung. Fast die Hälfte aller Parteimitglieder ist zwischen 41 und 60 Jahre alt, in der Bevölkerung gehört nur ein Drittel in diese Altersgruppe. Dramatisch ist die Unterrepräsentation von Frauen: 74 Prozent aller Parteimitglieder sind Männer, folglich sind nur 26 Prozent Frauen.
Besonders Angehörige des öffentlichen Dienstes sind in allen Parteien so stark überrepräsentiert, dass Beobachter seit langem "eine personale Verschränkung zwischen Mitgliederorganisation der Parteien und Staatsverwaltung"3 konstatieren. Unter der Dominanz von Staatsbediensteten und Rentnern verschwindet fast das Gewicht von Arbeitern und Angestellten aus der privaten Wirtschaft: In der Bevölkerung machen sie zwar 34 Prozent aus, in den Parteien jedoch nur 20 Prozent.
Allen politischen Parteien fehlt der Nachwuchs. Und der, der noch da ist, wendet sich frustriert ab. Die goldene Zeit der Mitgliederparteien ist vorbei. Das betrifft vor allem die SPD. So konnte die CDU 2008 zwar stolz verkünden, dass sie erstmals mehr Mitglieder hat als die SPD, die sich mehr als hundert Jahre stolz als die klassische Mitgliederpartei rühmte. Doch auch das ist nur vordergründig ein Erfolg. Er täuscht darüber hinweg, dass die beiden großen Parteien kaum weniger als halb so viele Menschen binden wie noch 30 Jahre zuvor.
Die Zahl sinkt weiter und wird weiter sinken. Es ist ein säkularer Trend, der sich auf die eine oder andere Weise in allen entwickelten repräsentativen Demokratien abspielt. Die politischen Parteien waren ein Phänomen des ideologischen Zeitalters, in dem weltanschauliche Organisationen einander gegenüberstanden und um Anhänger wetteiferten.
Die Volksparteien wiederum waren und sind zum Teil noch immer ein Phänomen, das die ganze Verlogenheit der repräsentativ-demokratischen Scheinwelt für jedermann erkennbar entlarvt. Kein Wunder, dass nach und nach selbst die dümmsten Wähler längst ahnten oder gar klar erkannten, dass die Politik der Volksparteien anderen Interessen dient als denen des gemeinen Volkes. Die etablierten Politiker haben viel zu lange Zeit geglaubt, sie könnten die Wähler hinters Licht führen. Sie haben sich fatal geirrt.
Entfremdung charakterisiert das Verhältnis der Bürger zur Politik
Der Rückzug der Bürger aus den politischen Parteien ist ein Ausdruck der wachsenden Entfremdung zwischen der Bevölkerung und ihren politischen Repräsentanten. Die CDU hatte schließlich nicht deshalb mehr Mitglieder als die SPD, weil sie so attraktiv geworden war. Der höhere Mitgliederstand ergab sich auf Grund der in der SPD grassierenden Schwindsucht. Auf ihrer rasanten Talfahrt raste die SPD an der traditionell mitgliederschwachen CDU vorbei. Und die CDU rühmte sich nicht etwa der eigenen Attraktivität, sondern der Schwäche der Konkurrenz …
An diesem "historischen Tag" - so der damalige Generalsekretär Roland Pofalla -, dem 30. Juni 2008, hatte die CDU insgesamt 530.755 Mitglieder und damit 761 Mitglieder mehr als die SPD.
Da wird viel ein- und noch mehr ausgetreten. Die Fluktuation ist in allen politischen Parteien extrem hoch. Viele der neuen Mitglieder treten entsetzt wieder aus, nachdem sie erst einmal erlebt haben, wie verpieft es in Ortsvereinen hergeht. Offensichtlich sind das für viele Menschen Stätten des nackten Grauens. Sie ergreifen noch schneller die Flucht, als sie die Mitgliedschaft erworben haben.
Der Exodus aus den Parteien hält jedenfalls ungebrochen an. Und da sich an den Bedingungen, die ihn herbeigeführt haben, nichts ändert, wird er sich noch viele Jahre fortsetzen. Die Mitgliederzahlen der Parteien tendieren auf jeden Fall mit hoher Geschwindigkeit gegen Null.
Mitte der 1970er Jahre hatte allein die SPD noch 1,022 Millionen Mitglieder. CDU und CSU kamen zusammen auf noch einmal so viele. Seitdem geht es mit den Volksparteien rapide bergab. Die Mitgliederzahl der SPD schrumpfte seither rasant und dümpelt 2018 bei 449.870. Es geht weiter bergab.
Das Heer der reitenden Karteileichen
Wenn man bedenkt, dass selbst von den wenigen Mitgliedern eine nicht verlässlich bezifferbare Zahl reine Karteileichen sind, erlaubt das nur die Feststellung: Das politische Establishment der SPD hat den Status einer Mitgliederpartei und damit den besonderen Nimbus der einstigen Arbeiterpartei über Jahrzehnte hinweg gnadenlos versemmelt.
Anders als die bürgerlichen Parteien, in denen sich eher das gehobene Bürgertum locker zusammenschloss, war die alte SPD eine straff organisierte Arbeiterpartei, deren Mitglieder die Partei zum größten Teil auch finanzierten. Heute ist sie nur eine von mehreren bürgerlichen Allerweltsparteien.
Wie dramatisch die innere Auszehrung der Parteien ist, wird deutlich an der Situation der SPD: Selbst nach dem 2. Weltkrieg und den Jahren des Dritten Reichs hatte die Partei 1949 noch 750.000 Mitglieder. Die Terrorherrschaft der Nazis und der Weltkrieg haben nicht so destruktiv zur Auszehrung der Parteien beigetragen wie viele Jahre repräsentativer Demokratiepraxis.
Die Zahl wuchs bis 1976 sogar auf über eine Million und sank von da an ungebremst. Allein in den 20 Jahren von 1995 bis 2015 verlor die SPD rund 372.000 Mitglieder. Und ein Ende ist nicht in Sicht.
Die CDU zählt 2018 gerade mal 425.910 Mitglieder und damit wieder weniger als die SPD. Parteiinterne Rechnungen gehen davon aus, dass sich die Mitgliederzahl im Osten zum Jahr 2019, diejenige im Westen bis 2024 halbieren wird. Wer von den beiden Volksparteien gerade mehr oder auch weniger Mitglieder hat, ist relativ gleichgültig; denn beide stehen auch beim Schrumpfen in edlem Wettbewerb um den vordersten Platz.
Die CSU, die Schwesterpartei der CDU in Bayern, bewegt sich 2018 bei 140.983 Mitgliedern. Tendenz wie bei allen anderen auch sinkend, und das seit Jahren. Die Linke kam Ende 2018 auf 62.298 Mitglieder. Tendenz sinkend.
Lediglich mit dem Bündnis 90/Die Grünen weht bei Mitglieder- und bei Wählerzahlen derzeit ein anhaltender kräftiger Aufwind. Einer der Gründe dafür dürfte es sei, dass die Bündnisgrünen in der Öffentlichkeit am wenigsten als eine der klassischen Altparteien auftritt, auch weniger belastet ist und sich eher wie eine anwachsende Bewegung auftritt.
Das Parlament repräsentiert eine verschwindende Minderheit
Zählt man das zusammen, so ergibt sich: Die Abgeordneten des Bundestags repräsentieren gerade mal rund um eine Million Leute. Bei einer Bevölkerung von rund 80 Millionen ist das ziemlich mickrig - erst recht wenn man bedenkt, dass längst nicht alle Personen, die formal als Mitglieder geführt werden, auch tatsächlich in ihrer Partei aktiv sind. Im Gegenteil: Die überwiegende Mehrzahl ist passiv und nimmt am Parteileben selten, unregelmäßig oder überhaupt nicht teil.
Nach verschiedenen Untersuchungen beteiligen sich rund 40 Prozent aller Parteimitglieder niemals an irgendwelchen Parteiaktivitäten.4 "Die Organisationswirklichkeit der Parteien teilt sich dabei in zwei voneinander klar abgrenzbare Sphären: Eine Gruppe von Mitgliedern beteiligt sich in erster Linie im Rahmen ämterorientierter Aktivität, bringt sich in den Gremien ein und kandidiert für öffentliche Mandate und parteiinterne Ämter. Andere Mitglieder werden hingegen überwiegend durch gesellige Veranstaltungsformen angesprochen und sind nicht bereit, darüber hinaus Verantwortung zu übernehmen."5
Auch die meisten "Aktiven" unter den Parteimitgliedern engagieren sich nicht politisch. Die Partei ist für die meisten eher so eine Art geselliger Verein, eine verpiefte Kaffeefahrt für Senioren. Sie besuchen Weihnachtsfeiern, Grillabende oder Jubiläumsveranstaltungen:
Die Masse der Mitglieder (87 bzw. 77 Prozent) hat in den letzten fünf Jahren Versammlungen bzw. Feste und gesellige Veranstaltungen besucht. Beide Formen sind … die wichtigsten Kanäle des Mitgliederengagements. ... Alle anderen Formen der Mitarbeit folgen mit deutlichem Abstand. Einen mittleren Zuspruch genießen Aktivitäten, bei denen die Mitglieder ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen, wie das Kleben von Plakaten und die Verteilung von Flugblättern (56 Prozent) oder aber die Organisation der Parteiarbeit (55 Prozent).
Die Beteiligungsformen mit dem engsten Bezug zu politischen Entscheidungsprozessen schneiden am schlechtesten ab: Für ein Amt in der Partei kandidierten in einem Zeitraum von fünf Jahren lediglich 42 Prozent, und nur noch jedes dritte Parteimitglied (33 Prozent) strebte in dieser Zeit ein öffentliches Amt an.
Heinrich, Roberto/Lübker, Malte/Biehl, Heiko: Parteimitglieder im Vergleich: Partizipation und Repräsentation
Fasst man die Ergebnisse einer Vielzahl von Untersuchungen zusammen, so repräsentieren die Abgeordneten im Bundestag und in den Landtagen gerade mal so um die 300.000 bis maximal 500.000 Aktivisten der politischen Parteien. Auf jeden Fall also eine verschwindend kleine Minderheit. Sonderlich repräsentativ ist das nicht und unter allen Umständen meilenweit von jedem demokratischen Ideal entfernt.
Die Demokratietheorie versteht die politischen Parteien gern als das Bindeglied zwischen Staat und Gesellschaft, zwischen der Politik und der Bevölkerung. In den Ortsvereinen nimmt der Staat sozusagen den Kontakt zu den Menschen "draußen im Lande" auf und rekrutiert seinen politischen Nachwuchs. Wenn das so sein sollte, hängt der Staat bestenfalls an einem dünnen Faden, der jederzeit in Gefahr ist, unter der kleinsten Belastung zu zerreißen, zumal er immer dünner wird. Die Selbstauszehrung der klassischen Volksparteien droht, den dünnen Faden endgültig zu zerfetzen.
Ein kleiner Klüngel von Funktionären besetzt alle Ämter
Das Monopol der Parteien bei der Rekrutierung der Politiker aus der Mitte ihrer Mitglieder wirft Fragen danach auf, wie die Kandidaten parteiintern überhaupt ausgewählt werden. Da die meisten Parteimitglieder inaktiv sind, entscheidet tatsächlich in jeder Partei eine kleine Gruppe von Funktionären und Aktivisten über alle Kandidaturen.
Die Basis derjenigen, die de facto über die Mitglieder des Parlaments und alle anderen Amtsträger bestimmen, ist winzig. Es sind fast ohne Ausnahme Funktionäre, die entweder selbst Mitglied der politischen Kaste sind, danach streben, ihr künftig anzugehören oder aber Leute, die ihre aktive Zeit bereits hinter sich haben und in Parteisitzungen herumlungern, weil sie sich nicht allein betrinken mögen.
In ihren Parteien üben die Angehörigen der politischen Kaste starken Einfluss aus. Man kann sagen, dass die quantitativ kleine, aber sehr mächtige politische Kaste sich (parteispezifisch differenziert) gewissermaßen selbst reproduziert6, und dass die "Macht der Parteien" im Wesentlichen von einer dünnen Schicht von Funktionären ausgeübt wird.
Es geschieht den politischen Parteien kein Unrecht, wenn man resümiert, dass sie nach Abzug der Inaktiven, der Indifferenten, der Unpolitischen und der Karteileichen im günstigsten Fall zwischen 300.000 bis maximal 500.000 aktive Mitglieder haben. Wahrscheinlich sind es sogar viel weniger. Sie "repräsentieren" das Millionenvolk der Bürger. Das läuft auf allerhöchstens ein Prozent der wahlberechtigten Bevölkerung hinaus.
Die praktische Politik indes geht stets davon aus, dass die demokratietheoretische Fiktion gilt, dies seien die Repräsentanten des Volks. Doch das wählende oder auch nicht wählende Volk hat den Schwindel längst durchschaut und wendet sich entsetzt und angewidert ab. Es sind nur diese wenigen Leute, die Einfluss auf die Nominierung von Kandidaten für politische Wahlämter nehmen können. Und das Argument ist nicht von der Hand zu weisen, dass dies eher eine Negativauslese ist.
Heute prägen Opportunisten und Karrieristen die Szene in allen Volksparteien. Wer in eine Partei eintritt, überlegt, welchen Nutzen das für ihn hat. Wer beruflich auf der Stelle tritt und durch berufliche Leistung nicht weiterkommt, kann es auch ohne fachliche Qualifikation mit Hilfe einer Partei noch einigermaßen weit bringen und ein gut bezahltes Amt bekommen. Die Führungskräfte der Parteien sind auf jeden Fall keine Positivauslese. Am Ende der Ochsentour durch die Hierarchie einer Partei stehen lauter Rindviecher …
Auch dies ist ein schleichender Prozess, der sich in den letzten Jahren vollzogen hat. Und niemand sollte die potenziellen Wählerinnen und Wähler unterschätzen. Die haben längst gemerkt, dass sie verschaukelt werden und kein Politiker sich sonderlich für ihre soziale und wirtschaftliche Lage interessiert.
Amtsträger wie Wirtschaftsbürgermeister, Regierungspräsidenten, Landräte, Universitätsrektoren, Schuldirektoren, Verfassungsrichter, Amtsrichter, Geschäftsführer der Gesetzlichen Krankenkassen, Direktoren der Stadtwerke, Vorsitzende des Verwaltungsrats von Landesbanken, die Aufsichtsräte staatlicher Einrichtungen, die Intendanten des öffentlichen Fernsehens und Rundfunks, die Direktoren von Sparkassen, Krankenhausdirektoren, Bundesligapräsidenten und sogar Karnevalsprinzen werden in aller Regel von den politischen Parteien berufen. Was für eine Mixtur lokaler Würdenträger!
Das faktische Verhalten und der Einfluss der Volksparteien bestätigen die Beobachtung Richard von Weizsäckers aus den frühen 1980er Jahren, dass "sie sich den Staat zur Beute gemacht haben". Sie seien machtversessen und machtvergessen zugleich. Die Volksparteien haben sich den Staat untertan gemacht.
Die Parteien haben ihren Einfluss weit über das Maß hinaus ausgedehnt, das der Artikel 21 des Grundgesetzes ihnen einräumt. Der formuliert ja geradezu scheinheilig: "Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit." Was für eine Verharmlosung! Danach bildet das Volk seinen Willen und die politischen Parteien dürfen dabei hier und da ein bisschen mitwirken. Genau umgekehrt wird ein Schuh draus: Die politischen Parteien haben alles unter Kontrolle. Doch das Volk hat nichts zu sagen. Tatsächlich haben die politischen Parteien und allen voran die Volksparteien alle politischen Prozesse bis weit über die Grenze des Erträglichen usurpiert.
Eine stärkere Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger lehnen die Parteien und ihre Repräsentanten strikt ab. Probleme instrumentalisieren sie, um einander gegenseitig zu bekämpfen, statt sie zu lösen. Insgesamt haben sie sich zu einem ungeschriebenen sechsten Verfassungsorgan entwickelt, das auf die anderen fünf Verfassungsorgane einen immer weitergehenden, völlig beherrschenden Einfluss nimmt.
Dennoch seien die Parteien machtvergessen, weil sie ihren inhaltlichen und konzeptionellen politischen Führungsaufgaben nicht nachkommen. Ihre Utopie sei der Status quo, ein Leben auf Kosten der Zukunft, um sich die Gegenwart zu erleichtern. Außerdem haben sie die Kontrolle der Exekutive durch das Parlament außer Kraft gesetzt.
Apathie und Vertrauensverlust prägen die Postdemokratie
Der britische Politikwissenschaftler Colin Crouch bezeichnet die permanente Krise der konsolidierten repräsentativen Demokratien als "Postdemokratie". Genauer gesagt behauptet er, dass die bestehenden Demokratien auf einen idealtypischen Zustand zusteuern, den er Postdemokratie nennt. Das ist ein Zustand, in dem Vertrauensverlust, fehlender Glaube an Veränderung und politische Apathie das Bild der Bevölkerung prägen.
Das Wundersame daran ist, dass die institutionellen Grundgerüste der Demokratie - wie freie Wahlen, Parteienwettbewerb, Gewaltenteilung - formal weiterhin funktionieren. Sie haben jedoch jegliche Legitimation verloren, weiterhin die Grundlage der Demokratie darzustellen. Wahlen und demokratische Vorgänge dienen nur noch als Deckmantel, um das Regieren einer kleinen privilegierten Machtelite zu legitimieren.
Dabei sind die demokratischen Institutionen und Verfahren formal, aber auch nur formal, völlig intakt - es gibt einen Wettbewerb der politischen Parteien, regelmäßig werden Wahlen abgehalten, und formal funktioniert sogar noch die Gewaltenteilung.
Aber wahre Demokratie erschöpft sich nicht in Formalismen. Eine formale Demokratie ohne Substanz ist inhaltslos. Und de facto sind die Institutionen der entwickelten Demokratien entkernt, weil die Bürger nicht länger am politischen Geschehen teilnehmen. Sie sind teilnahmslos geworden.
Das liegt nicht an den Bürgern, sondern an der Substanzlosigkeit der politischen Willensbildungsprozesse. Da die westlichen Demokratien jedoch auf bürgerschaftlichem Engagement und damit auf Legitimation basieren, reißt dort eine Legitimationslücke auf, die das politische System durch Output - Gesetze, Entscheidungen, Verordnungen und sonstige Regelungen - notdürftig füllt.
In der Postdemokratie spielen die Wähler keine Rolle mehr
Die Postdemokratie ist also ein Regierungssystem, in dem die formalen demokratischen Institutionen de facto von privilegierten Wirtschaftseliten kontrolliert werden und nicht mehr von den Bürgern. Galt früher eine Demokratie durch ihren Input, die Partizipation ihrer Bürger, als legitim, so rechtfertigt sie sich in postdemokratischen Zeiten vornehmlich durch ihren Output.
Die Wähler spielen, wenn überhaupt, nur noch eine untergeordnete Rolle und sind für die Entscheidungsfindung nicht mehr wichtig. Das System der politischen Willensbildung löst sich vom einstigen Souverän der Demokratie ab und funktioniert ohne ihn weiter.
Man kann das im Wortsinn beschreiben. Die Herrschaft - griechisch: κρατία - trennt sich vom Souverän, dem Volk - griechisch: δῆμος - und macht alleine weiter. Doch eine Volksherrschaft, in der das Volk nicht vorkommt, ist nur noch Herrschaft, keine Volksherrschaft, keine Demokratie. Am Ende also pure Herrschaft ohne demokratische Basis.
Doch es ist an den Haaren herbeigezogen, zwischen formalem Funktionieren und materiellem Nichtfunktionieren zu unterscheiden. Ein demokratisches System lässt sich auf reine Formalismen nicht reduzieren. Wenn es in der Substanz entleert ist, dann funktioniert es auch formal nicht. Dann funktioniert es überhaupt nicht. Der Apparat rattert bloß richtungslos, aber keinesfalls geräuschlos, vor sich hin.
Eine lebendige Demokratie kann nicht ohne den konstruktiven Dialog zwischen Regierenden und Regierten, zwischen Politikern und Bürgern auskommen. Und erst in einem solchen Dialog entfaltet sich gelebte Demokratie. Formale Demokratie ist keine Demokratie. Noch nicht einmal eine leere Hülse. Sie ist überhaupt keine Demokratie.
In den entwickelten repräsentativen Demokratien funktionieren auch die institutionellen Grundgerüste schon lange nicht mehr. Wenigstens nicht mehr auf demokratische Weise. Auch nicht formal. Es sind wohlgeschmierte Räderwerke, die ineinander greifen und wie ein Uhrwerk ablaufen. Sie sind völlig pervertiert und zu Instrumenten des Machterhalts und der Versorgung der herrschenden Machteliten verkommen.
Die klassischen Volksparteien haben sich nur noch in von PR-Experten als Wahlkämpfe inszenierten Schauspielen künstlich am Leben erhalten können, die einige politische Themen für die Bevölkerung theatralisch in Szene setzen und ihr dabei vorgaukeln, sie habe etwas zu entscheiden und etwas auszuwählen.
Sie hat aber nichts auszuwählen; denn die Themen haben sich die Parteiführer und ihre PR-Agenten schon vorher herausgepickt, und zwar nicht nach dem Gesichtspunkt, welche Themen der Bevölkerung unter den Nägeln brennen. Ganz im Gegenteil, solche Themen werden absichtlich ausgeblendet.
Ausgewählt werden Themen, mit denen man Wahlen zu gewinnen hofft. In Wahrheit darf die Bevölkerung nur herunterschlucken, was die Parteizentralen ihr vorgekaut haben. Die Bevölkerung ist zum Wiederkäuer der Volksparteien degradiert worden.
Die Bürger spielen nur noch eine passive Rolle, unfähig zur eigenen Gestaltung der Auseinandersetzung. Im Rücken dieser Inszenierung des Wahlspiels findet der tatsächliche politische Prozess statt und zwar in Form einer privatisierten Interaktion zwischen gewählten Regierungen und Eliten, die größtenteils die Interessen wirtschaftlich starker Akteure vertreten.
An die Stelle einer durch Wahlen vermittelten Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger an den politischen Entscheidungen sind intransparente Verhandlungen getreten, und der demokratische Prozess dient einzig der Erzeugung von Massenloyalität. Viele Jahre, ja Jahrzehnte, hat die breite Bevölkerung das mit sich machen lassen. Aber zumindest intuitiv hat sie das üble Spiel längst durchschaut.
Wahlen ohne Sinn und Substanz
Nach Crouch ist eine Postdemokratie "ein Gemeinwesen, in dem zwar nach wie vor Wahlen abgehalten werden ..., in dem allerdings konkurrierende Teams professioneller PR-Experten die öffentliche Debatte während der Wahlkämpfe so stark kontrollieren, dass sie zu einem reinen Spektakel verkommt, bei dem man nur über eine Reihe von Problemen diskutiert, die die Experten zuvor ausgewählt haben".7
Die Einbeziehung der Bevölkerung in Wahlen dient nur dazu, die Loyalität der Massen zu erhalten, da so der demokratische Schein bestehen bleibt. Crouch postuliert, "je mehr sich der Staat aus der Fürsorge für das Leben der normalen Menschen zurückzieht und zulässt, dass diese in politische Apathie versinken, desto leichter können Wirtschaftsverbände ihn - mehr oder minder unbemerkt - zu einem Selbstbedienungsladen machen. In der Unfähigkeit, dies zu erkennen, liegt die fundamentale Naivität des neoliberalen Denkens".8
Durch den Begriff Postdemokratie kann man nach Crouch besser "Situationen beschreiben, in denen sich nach einem Augenblick der Demokratie Langeweile, Frustration und Desillusionierung breitgemacht haben; in denen Repräsentanten mächtiger Interessengruppen ... weit aktiver sind als die Mehrheit der Bürger ...; in denen politische Eliten gelernt haben, die Forderungen der Menschen zu manipulieren; in denen man die Bürger durch Werbekampagnen 'von oben' dazu überreden muss, überhaupt zu Wahl zu gehen."9
Mit anderen Worten: Die entwickelte repräsentative Demokratie ist nichts als "eine Scheindemokratie im institutionellen Gehäuse einer vollwertigen Demokratie"10. Alle Institutionen sind leere Hülsen ohne Inhalt und ohne Substanz. Die Parlamente haben nichts mehr zu entscheiden, was nicht an anderer Stelle und vor ihnen längst entschieden wurde. Die Wahlkämpfe sind zu großangelegten Schaukämpfen verkommen, in denen außer Schaumschlägerei nichts passiert.
Selbst Parteitage - einst zentrale Orte der politischen Willensbildung und Foren der Auseinandersetzung um wichtige gesellschaftliche Zukunftsfragen - sind nichtssagende Veranstaltungen geworden, die überwiegend unter medialen Wirkungsaspekten durchkomponiert werden und auf denen vor allem für das Fernsehen paradiert wird. Und der Parteivorsitzende muss immer eine "kämpferische Rede" halten, die überzeugend begründet, warum nur eine einzige Partei existiert, die alle Probleme der Politik zu lösen vermag, und warum er und sonst niemand der nächste Kanzlerkandidat werden muss.
Parteitage wie einst bei den Kommunisten
Der Politikwissenschaftler Arnulf Baring hat für Parteitage nur noch blanke Verachtung übrig. Sie sind nach seinen Worten "streng hierarchisch von oben nach unten durchorganisiert. Es gelingt kaum einem Kritiker, als Delegierter zu einem Parteitag entsandt zu werden." Selbst CDU-Parteitage sind für ihn gar "Veranstaltungen, wie wir sie aus ehemals kommunistischen Ländern kennen".11
Auch Bürger, die sich nicht viel mit Politik befassen, haben den Zirkuscharakter des öffentlichen Auftretens von Politikern und politischen Parteien längst durchschaut und reagieren mit Verachtung, Desinteresse und Apathie. Man kann ihnen das nicht verübeln. Denn statt Personen und Institutionen, die sich für das Gemeinwohl einsetzen, bekommen sie die rhetorischen Kunststückchen von Zirkusgäulen vorgeführt.
Das langweilt. Es ist doch nur konsequent, wenn sie aufhören, sich überhaupt für Politik zu interessieren und immer seltener wählen gehen. Die klassischen Volksparteien bekommen das seit Jahren zu spüren. Und sie haben es nicht besser verdient; denn sie haben das ihre dazu beigetragen, dass die totale Vernebelung der politischen Verhältnisse sich allenthalben ausbreiten konnte.
Die parlamentarische Debatten(un)kultur passt nicht mehr
Das Informations- und Kommunikationszeitalter erfordert eine neue Diskurskultur. Der banale Streit darum, wer jetzt gerade Recht hat und schon immer Recht hatte oder die besseren Konzepte verficht, ist nicht mehr zeitgemäß. Er ist verantwortungslos. Gebraucht wird eine Lösungskultur und ein gemeinsamer Lösungsdialog, der Parteigrenzen überwindet, nicht aber sie in Stein meißelt.
Es festigt sich im Lande die Überzeugung, dass unser Parteiensystem, in welcher Farbkombination auch immer, den heutigen Herausforderungen in keiner Weise gewachsen ist und daher von der Krise verschlungen werden wird, wenn es nicht die Kraft zur durchgreifenden Erneuerung findet. Wenn unsere Parteien weder programmatisch noch personell in der Lage sind, die Bevölkerung mit klaren Alternativen zu konfrontieren und damit Richtungsentscheidungen zu erzwingen, ist diese Republik am Ende.
Arnulf Baring
Aber eine Diskurskultur, die Lösungen für Probleme zu erarbeiten versucht, kann aus einer parlamentarischen Parteiendemokratie aus strukturellen Gründen nicht hervorgehen. Man kann sich das von Herzen wünschen - so wie den Weltfrieden. Aber der wird deshalb auch nicht kommen.
Die Struktur der Parlamente in Parteienstaaten mit ihren Regierungsmehrheiten und Oppositionsminderheiten, ihren Fraktionen und ihrem Fraktionszwang steht einer lösungsorientierten Diskurskultur entgegen und macht sie unmöglich. An die Stelle des möglicherweise einmal lebendigen demokratischen Gebilde ist ein allumfassendes gewaltiges Lügengebäude getreten, dessen gesamte Struktur nur einem einzigen Zweck dient, die gesamte Bevölkerung gezielt hinters Licht zu führen.
Es hilft nicht, wenn man bloß über die Politiker und ihre nichtssagenden Reden in den Parlamenten schimpft; denn dahinter stehen institutionelle Zwänge, und erst wenn die beseitigt sind, würde eine parlamentarische Redekultur möglich sein, bei der am Ende sinnvolle Ergebnisse herauskommen. Aber so lange die Volksparteien in ihrer gegenwärtigen Gestalt nicht verschwinden, verschwinden auch nicht von selbst diese Zwänge.
Empfohlener redaktioneller Inhalt
Mit Ihrer Zustimmmung wird hier eine externe Buchempfehlung (Amazon Affiliates) geladen.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen (Amazon Affiliates) übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
