Über die ignorierten Kollateralschäden von Lockdowns
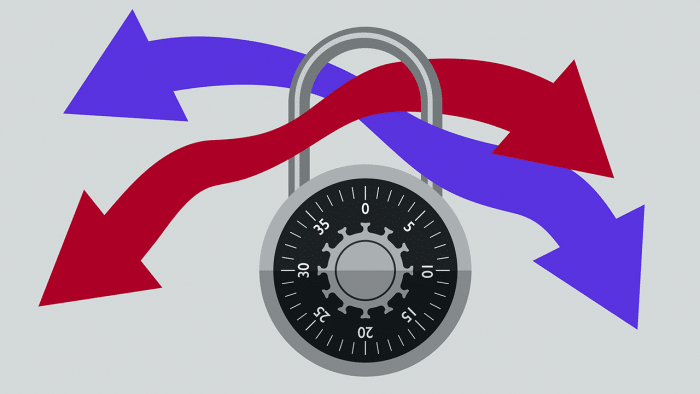
- Über die ignorierten Kollateralschäden von Lockdowns
- Eingeschränkte Schulbildung, steigender Alkoholkonsum
- Auf einer Seite lesen
Maßnahmen gegen die Pandemie müssen gegen die negativen Folgen abgewogen werden – was zu wenig geschieht. Etwa mit Blick auf Akuterkrankungen, Minderjährige und Suchtverhalten. (Teil 2)
Ab dem 16. Dezember wurde von den Regierungen ein "harter Lockdown" verhängt, der zunächst bis zum 10. Januar gelten soll. In einer Serie von drei Artikeln werden die wissenschaftlichen Begründungen genauer beleuchtet. Im ersten Artikel werden die fehlenden wissenschaftlichen Beweise für die Wirksamkeit von Lockdowns thematisiert. Im zweiten Artikel werden die in den Stellungnahmen der Fachgesellschaften und den Regierungserklärungen ignorierten Kollateralschäden von Lockdowns beschrieben, welche inzwischen durch zahlreichen Studien belegt sind. Im dritten Artikel wird anhand einer kritischen Diskussion der vom Robert-Koch Institut veröffentlichten Corona-Fallzahlen beleuchtet, inwiefern eine Angst in der Größenordnung, wie sie von den Regierungen, den Medien und manchen Wissenschaftlern vermittelt wird, wirklich gerechtfertigt ist.
Teil 1: Über die fehlenden wissenschaftlichen Beweise für die Wirksamkeit
Es folgt:
Teil 3: Warum wir eigentlich keine extremen Ängste haben müssen
Am dem 16. Dezember wurde das öffentliche Leben in Deutschland erneut drastisch heruntergefahren. Der Einzelhandel mit Ausnahme der Geschäfte für den täglichen Bedarf musste schließen, Schulen und Kindergärten wurden geschlossen, weiterhin gelten strikte Kontaktbeschränkungen. Empfohlen hatte einen solchen "harten Lockdown" unter anderem die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina in ihrer 7. Ad-hoc-Stellungnahme.
Liest man als Wissenschaftler die Stellungnahme der Leopoldina oder hört man sich die darauf aufbauenden Begründungen in den Regierungserklärungen an, stellt sich ein großes Befremden ein: Bei der Verordnung von Maßnahmen für Millionen von Menschen würde man eigentlich nicht nur davon ausgehen, dass geprüft wurde, inwiefern die Wirksamkeit einer Maßnahme als wissenschaftlich gesichert gilt (für diesbezügliche Probleme siehe der erste Artikel dieser Serie zu den wissenschaftlichen Begründungen des "harten Lockdowns": Die fehlenden wissenschaftlichen Nachweise zur Wirksamkeit). Vielmehr würde man weiterhin erwarten, dass auch die möglichen Kollateralschäden einer Maßnahme geprüft, und der Nutzen einer Maßnahme gegenüber den Nebenwirkungen abgewogen wurde. Eine Maßnahme kann nur dann empfohlen werden, wenn deren Nutzen die Nebenwirkungen überwiegt.
Problematischerweise werden sowohl in der Stellungnahme der Leopoldina als auch in den Regierungserklärungen zur Verordnung des Lockdowns die umfangreichen Kollateralschäden eines harten Lockdowns auf der Ebene der körperlichen, psychischen und sozialen Gesundheit komplett ignoriert, welche inzwischen in zahlreichen Studien belegt sind. Die Stellungnahme der Leopoldina sowie das Handeln der Regierungen verletzt damit die Prinzipien einer evidenzbasierten Medizin.
Das Ignorieren der Kollateralschäden von Lockdowns
In der Stellungnahme der Leopoldina werden die Kollateralschäden eines Lockdowns nur folgendermaßen thematisiert:
Zwar erhöhen sich durch einen strengeren Lockdown kurzfristig die [wirtschaftlichen] Wertschöpfungsverluste, aber zugleich verkürzt sich der Zeitraum, bis die Neuinfektionen so weit gesunken sind, dass Lockerungen möglich werden.
Ansonsten werden keinerlei Nebenwirkungen in Betracht gezogen. Das ist höchst fragwürdig, da inzwischen empirisch belegt ist, dass ein Lockdown mit dramatischen Nebenwirkungen auf die körperliche, psychische und soziale Gesundheit von Menschen verbunden ist.
Ein publizierter Artikel des renommierten Medizinwissenschaftlers und Statistikers John Ioannidis bietet einen ersten Überblick über die mit den ergriffenen Corona-Maßnahmen verbundenen Kollateralschäden. Dort ist folgende Tabelle dazu abgebildet:
| Possible non‐COVID‐19 causes of excess deaths compounded by aggressive measures taken for COVID‐19 | ||
| Cause of excess death | Reason/comments | Possible time horizon for excess deaths |
| People with AMI (acute myocardial infarction) and other acute disease not given proper hospital care | Patients afraid to go to hospital and hospitals reducing admissions afraid of overload | Acute, during pandemic |
| People with cancer having delayed treatment | Postponement of cancer treatment in anticipation of COVID‐19 overload | Next 5 y |
| Disrupted cancer prevention | Inability to offer cancer prevention services under aggressive measures | Next 20 y |
| Other healthcare disruption | Postponement or cancellation of elective procedures and regular care | Variable for different medical conditions |
| Suicides | Mental health disruption | Both acute and long‐term |
| Violence (domestic, homicide) | Mental health disruption | Acute, possibly long‐term |
| Starvation | Disruption in food production and transport | Acute, and possibly worse over next several years |
| Tuberculosis | Disruption of tuberculosis management programmes | Next 5 y |
| Childhood diseases | Disruption of vaccination programmes | Next 5 y |
| Alcoholism and other diseases of despair | Mental health disruption, unemployment | Next 10 y |
| Multiple chronic diseases | Unemployment, lack of health insurance and poverty | Next 20 y |
| Lack of proper medical care | Disruption of healthcare, as hospitals and health programmes get financially disrupted, furlough personnel or even shut down services | Next 20 y |
Um die Größenordnung der Nebenwirkungen zu verdeutlichen, kann man zunächst die in Deutschland beobachtete Übersterblichkeit für das Jahr 2020 im Vergleich zu den Jahren 2016-2019 und die Anzahl der mit oder am Virus Sars-CoV-2 verstorbenen Personen betrachten. In der folgenden Abbildung zeigt die Höhe der blauen Balken die Übersterblichkeit bzw. Untersterblichkeit pro Kalenderwoche (Anzahl der mehr bzw. weniger verstorbenen Personen im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2016-2019). Die Höhe der roten Balken zeigt die Anzahl der mit und am Sars-CoV-2-Virus verstorbenen Personen:
Wie die Grafik zeigt, ist seit dem Beginn der Corona-Krise Anfang März im Vergleich zur durchschnittlichen Anzahl von Todesfällen in den Jahren 2016-2019 in vielen Wochen eine Übersterblichkeit zu beobachten. Diese geht aber nur zu 51,1 Prozent auf mit und am Sars-CoV-2-Virus verstorbene Personen zurück. In etwa die Hälfte der beobachteten Übersterblichkeit geht auf andere Todesursachen zurück.
Hier wird manchmal das Argument ins Feld geführt, dass die Sars-CoV-2-bedingten Todesfälle untererfasst seien. Vermutlich ist aber eher das Gegenteil der Fall, denn bei schweren Fällen und Todesfällen wurde sehr flächendeckend auf Sars-CoV-2 getestet . Zudem verstarb ein größerer Prozentanteil der als "Sars-CoV-2-Todesfälle" geführten Sterbefälle in Wirklichkeit an anderen Ursachen und wies nur ein positives Sars-CoV-2-Testergebnis auf.
Laut den offiziellen Zahlen aus Bayern sind beispielsweise nur 81,8 Prozent der als "Sars-CoV-2-Todesfälle" statistisch geführten Sterbefälle ursächlich an diesem Virus verstorben.
Studien legen nahe, dass die unabhängig von Sars-CoV-2 beobachtete Übersterblichkeit – abgesehen von zufälligen jahreszeitbedingten Schwankungen wie z.B. aufgrund von Hitzewellen – auf Nebenwirkungen der Maßnahmen zurückgeht. So hat eine kürzlich als Preprint veröffentlichte Studie zur Region Waldshut in Deutschland ergeben, dass von der dort im April beobachteten Übersterblichkeit 45 Prozent nicht auf mit oder am Sars-CoV-2-Virus verstorbene Personen zurückgeht, sondern auf andere Todesursachen. Die Autoren schreiben hierzu in der Zusammenfassung (Übersetzung durch den Autor):
Wir gehen davon aus, dass die Furcht, sich in überlasteten Krankenhäusern zu infizieren, eine einseitige öffentliche Kommunikation und Berichterstattung sowie das Ausmaß der Kontaktbeschränkungen erheblich zum Rückgang der behandelten Fälle und zur Übersterblichkeit beigetragen haben (Kollateralschaden). Für ähnliche Situationen in der Zukunft wird dringend empfohlen, die Krisenkommunikation und die Berichterstattung in den Medien ausgewogener zu gestalten, um Menschen mit akuten Gesundheitsproblemen nicht davon abzuhalten, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Kontaktbeschränkungen sollten kritisch überprüft und auf das objektiv notwendige Minimum beschränkt werden.
Dass durch einen Lockdown herbeigeführte Kontaktbeschränkungen das Sterberisiko erhöhen können, weiß man aus zahlreichen psychologischen Studien. So ergab eine Meta-Analyse aus dem Jahr 2015, dass sich die Sterbewahrscheinlichkeit bei sozialer Isolation um 29 Prozent und bei Einsamkeit um 26 Prozent erhöht, unabhängig davon, ob eine soziale Isolation von einer Person auch so empfunden wird – ein Effekt, welcher in der Größenordnung der Erhöhung des Sterberisikos durch mittelstarkes Rauchen liegt.
Eine als Preprint veröffentlichte Studie aus Großbritannien zeigt weiterhin, dass vor allem Menschen mit Demenz und psychischen Krankheiten von den negativen Folgen eines Lockdowns beeinträchtigt sind. Verglichen mit der Zeit zwischen Januar und Anfang März 2020 erhöhte sich während der Zeit des Lockdowns in Großbritannien die Sterbewahrscheinlichkeit von Demenzpatienten um 53 Prozent und von Patienten mit schwereren psychischen Störungen um 123 Prozent.
Wie zahlreiche Studien zeigen, geht die unabhängig von Sars-CoV-2 beobachtete Übersterblichkeit auch darauf zurück, dass viele Menschen mit akuten Gesundheitsproblemen durch die angstschürende Berichterstattung in den Medien und die soziale Isolation im Rahmen von Lockdowns davon abgehalten wurden, ihr Zuhause zu verlassen und medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Die Größenordnung dieser Kollateralschäden sind immens. So stieg laut einer Studie aus Großbritannien dort die Anzahl der Todesfälle aufgrund von Herzkrankheiten zur Zeit des Lockdowns im Vergleich zu den Vorjahren um in etwa 50-70 Fälle pro Tag. Vergleichsweise viele dieser Personen verstarben zu Hause anstatt in einer Klinik. Womöglich hätten also viele dieser Personen gerettet werden können, wenn sie rechtzeitig eine Klinik aufgesucht hätten.
Vergleichbare Befunde gibt es in Bezug auf andere Krankheiten wie beispielsweise Schlaganfälle. So zeigt eine Studie, dass in den USA die Anzahl der Krankenhauseinweisungen zur Zeit des Lockdowns um 31 Prozent im Vergleich zu vorher zurückging. Die Autoren schreiben dazu (Übersetzung durch den Autor):
Schlaganfalltherapien sind zeitkritisch, daher kann eine verminderte Inanspruchnahme der Gesundheitsversorgung zu mehr schlaganfallbedingten Behinderungen, mehr tödlichen Schlaganfällen und zu schwereren nicht-neurologischen Komplikationen im Zusammenhang mit Schlaganfällen führen.
Zudem belegen Studien, dass selbst bei den in Kliniken eingelieferten Patienten mit Herzkrankheiten die Sterberate zur Zeit des Lockdowns substantiell angestiegen ist. So ergab eine Studie der Medizinischen Universität Graz, dass in der Steiermark zur Zeit des Lockdowns im Vergleich mit den vorherigen vier Jahren die Sterberate bei den in Krankenhäusern aufgenommenen Patienten mit Herzkrankheiten um 65 Prozent zugenommen hat, bei Herzinfarktpatienten sogar um 80 Prozent.
Diese Anstiege können nicht durch Sars-CoV-2-bedingte Effekte erklärt werden, weil nur 6,2 Prozent der Patienten mit Herzkrankheiten ein positives Sars-CoV-2-Testergebnis aufwiesen und die vergleichsweise geringe Anzahl der verstorbenen Sars-CoV-2-Patienten den Anstieg in der Sterberate nicht erklären kann. Laut den Studienautoren ist die höhere Sterberate in Krankenhäusern vielmehr darauf zurückzuführen, dass Patienten zur Zeit des Lockdowns zu spät Kliniken aufsuchen, was die lebensrettende Behandlung verzögert und die Sterberate erhöht.
Auch in Bezug auf Krebserkrankungen ist inzwischen belegt, dass ein Nichtaufsuchen von Krankenhäusern aufgrund von angstschürenden Berichterstattungen und der sozialen Isolation im Rahmen von Lockdowns die Sterbezahlen langfristig deutlich erhöhen kann. So zeigte eine kürzlich publizierte Meta-Analyse, dass bereits eine vierwöchige Verschiebung einer Krebstherapie das Sterberisiko je nach Krebsart um sechs bis 13 Prozent erhöht.
Bei längeren Verschiebungen sind die Effekte noch drastischer. So erhöht ein Aufschub von acht Wochen bei Brustkrebs das Sterberisiko um 17 Prozent, ein Aufschub um zwölf Wochen um 26 Prozent. Die Autoren der Studie berechnen darauf aufbauend, dass beispielsweise eine Verschiebung aller Brustkrebsoperationen um zwölf Wochen zu 1.400 zusätzlichen Todesfällen pro Jahr in Großbritannien führen würde.
Weiterhin zeigen Studien, dass die Gewalt gegenüber Frauen und Kindern durch Lockdowns erhöht wird, weil Konflikte durch das erzwungene Verbleiben in der Wohnung erhöht werden, ein Entkommen des Opfers erschwert ist, Möglichkeiten des Hilfesuchens reduziert sind und die Schutz- und Früherkennungsfunktionen von Instanzen außerhalb der Wohnung (z.B. Schule) wegfallen. In einer publizierten Überblicksarbeit heißt es hierzu (Übersetzung durch den Autor):
Viele Opfer familiärer Gewalt (häusliche Gewalt, Kindesmisshandlung und Misshandlung von Haustieren) sehen sich derzeit möglicherweise einem "Worst-Case"-Szenario ausgesetzt - sie sind gefangen in einer Wohnung mit einer gewalttätigen Person mit einem extrem eingeschränkten Kontakt zur Außenwelt. (…) Darüber hinaus sind Schulen, Bibliotheken und Kirchen wichtige Bestandteile des Familienlebens auf der ganzen Welt. Familien, die zu Hause Opfer von Gewalt oder Missbrauch werden, geben an, dass diese Einrichtungen häufig hilfreiche emotionale Unterstützung bieten und eine Möglichkeit darstellen, sich aus ihrer schlimmen häuslichen Umgebung zu "erholen" - eine Erleichterung, die sie derzeit nicht mehr erhalten. (…) Die Risikofaktoren für familiäre Gewalt werden durch drohende Arbeitslosigkeit, reduziertes Einkommen, begrenzte Ressourcen und begrenzte soziale Unterstützung weiter erhöht.
Erste Studien legen nahe, dass die Auswirkungen dramatisch sind. So erhöhte sich laut einer Studie in einer Londoner Kinderklinik die Anzahl von Kindern, die wegen Kopfverletzungen aufgrund von Misshandlungen eingeliefert wurde, im Vergleich zur durchschnittlichen Häufigkeit pro Monat in den letzten drei Jahren in der Zeit des Lockdowns um das 1.493 Prozent, wobei die Autoren sogar vermuten, dass diese Zahl noch unterschätzt ist.
Ähnliche Ergebnisse gibt es zur Häufigkeit des sexuellen Missbrauchs. Laut Daten aus Irland ist die Anzahl an Personen, welche sich zur Beratung an Vergewaltigungs-Krisenzentren wendeten, zwischen März und Ende Juni im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres um 98 Prozent gestiegen. Auch hier ist wieder einzurechnen, dass eine soziale Isolation zu Hause für die Opfer die Möglichkeit des Hilfesuchens erschwert, und auch diese Zahl vermutlich eine Unterschätzung darstellt.
Generell leiden insbesondere Kinder unter den Wirkungen von Lockdowns. So ergab die sogenannte COPSY-Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf, dass sich 71 Prozent der Kinder und Jugendlichen durch die Kontaktbeschränkungen belastet fühlten, 27 Prozent berichteten, sich häufiger zu streiten und 37 Prozent der Eltern gaben an, dass Streits mit ihren Kindern öfter eskalierten. Bei 39 Prozent der Kinder und Jugendlichen verschlechterte sich das Verhältnis zu den Freunden durch die eingeschränkten persönlichen Kontakte, was fast alle Befragten belastete.
Der Anteil der Kinder und Jugendlichen mit geminderter gesundheitsbezogener Lebensqualität stieg von 15 auf 40 Prozent, das Risiko für psychische Auffälligkeiten von rund 18 auf 30 Prozent. Betroffen waren vor allem Kinder und Jugendliche, in deren Elternhaus ein schlechtes Familienklima herrscht und bei denen gleichzeitig entweder ihre Eltern einen niedrigen Bildungsabschluss oder einen Migrationshintergrund haben. Bei dieser Gruppe traten deutlich häufiger psychosomatische Beschwerden, eine deutlich geminderte Lebensqualität sowie ausgeprägtere Symptome von Angst und Depression auf.
