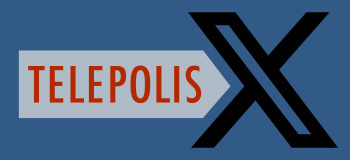Corona-Pandemie: Wie weit können sich Forscher aus dem Fenster lehnen?
Seite 2: Zweierlei Umgang mit Unsicherheiten
- Corona-Pandemie: Wie weit können sich Forscher aus dem Fenster lehnen?
- Zweierlei Umgang mit Unsicherheiten
- Auf einer Seite lesen
Warum holt man denn dann überhaupt die Wissenschaftler ins Boot bei politischen Entscheidungen?
Jörg Phil Friedrich: So funktioniert unsere politische Kultur, dass wir über Wissenschaft sehr viel legitimieren können. Der Grund ist, dass Wissenschaft, vor allem Naturwissenschaft, in den letzten Jahrhunderten unglaublich viele faszinierende Erkenntnisse produziert hat, die unser Verständnis über die Welt enorm erweitert haben. Aber da muss man auch unterscheiden. Wir tun immer so, als ob Physik das Komplizierte wäre, und deshalb sind wir gerade von der Physik so beeindruckt, eigentlich ist sie das einfachste.
In der Physik können wir etwas im Labor machen oder im Weltall beobachten, was sich über sehr lange Zeiträume entwickelt. Und da passiert zwar einiges, und es ist toll, dass wir das verstehen und sogar nutzen können. Aber wenn man das mal damit vergleicht, was zwischen Menschen, in einer Gesellschaft, passiert, dann haben wir da eine ganz andere Unsicherheit und Komplexität, weil wir das nicht so kontrollieren können wie ein Laborexperiment..
Aber wir nehmen dieses Wissenschaftsmodell der Physik und packen es auf gesellschaftliche Prozesse, die viel komplexer sind, weil die Menschen zum Beispiel von Überzeugungen geleitet werden, die sich ändern und die auf veränderte Situationen auch nochmal anders reagieren und da gibt es Rückkopplungsprozesse usf. und niemand weiß genau, wie sie sich entscheiden.
Selbst wenn Sie z.B. mit einer wissenschaftlichen Behauptung kommen "Wenn ihr euch so und so verhaltet, dann geht die Welt unter", werden Sie auf Vernünftige treffen, die sich so verhalten, dass die Welt nicht untergeht, aber auch auf andere, die sagen "Dann muss ich nochmal so richtig reingehen".
Das soll heißen: Die Erkenntnisgrundlagen zum Verhalten der Menschen sind komplex und schwierig. Dazu kommt, dass die Datenbasis, wenn es um solche Geschehnisse wie die Corona-Pandemie geht, oft dünn ist und dies nicht deutlich genug ausgewiesen wird. Vergleichen Sie das mit der Klimaforschung: Da haben wir seit vielen Jahrzehnten systematische Messungen in eng verbundenen Messnetzen, dazu Satellitenbeobachtungen, Eiskernbohrungen usw.
Es gibt zudem eine lange Erfahrung, wie diese Daten zusammenzuführen sind, um die Modelle zu initialisieren. In der Klimaforschung haben Sie zudem den Vorteil, dass es auf die Details des Wetterzustandes zum Start der Modellrechnung nicht genau ankommt. Das alles ist bei der Pandemieforschung anders. Es käme eigentlich schon auf die genauen Daten der Infektionsverteilung an, aber diese Daten haben wir nicht. Aber darauf wird bei den Präsentationen der Modellrechnungen nicht ausdrücklich hingewiesen.
So hört man zwar bei manchen Pandemieforschern im Nebensatz davon, dass die Datenbasis Lücken hat, aber in den Hauptsätzen, die nach außen dringen, wird formuliert: Das und das liefern unsere Modelle, so wird sich das Geschehen entwickeln. So dass ganz klare Aussagen gemacht werden, die den Eindruck erwecken, dass diese Modelle richtige Prognosen liefern.
Interessant ist allerdings, dass wir da zwei verschiedene Varianten beobachten können. Wissenschaftler, die sich auch in der Poltikberatung stark engagieren, wie etwa Melanie Brinkmann und Michael Meyer- Hermann vom Helholtz Zentrum für Infektionsforschung, neigen dazu, ihre Ergebnisse als eindeutige und klare Prognosen darzustellen.
Im Forschungs-Paper von Meyer-Hermann werden Sie darüber informiert, wo die Unsicherheiten liegen. Auf der Webseite finden Sie davon nichts.
Auf der anderen Seite haben Sie die Wissenschaftler aus Jülich, wo man mit einer nochmals anderen, großen Rechenpower tolle Modelle durchrechnet. Wenn Sie da auf die Webseiete schauen, dann steht eben sehr ausdrücklich da, dass das alles Szenarien sind, dass man das nicht als tatsächliche Prognose des Geschehens betrachten darf. Und diese Wissenschaftler sind auch nicht politisch aktiv.
Auffallend ist aus meiner Sicht eine ganz klare Korrelation zwischen dem Versuch, klare Aussagen zu formulieren, die unbedingter sind als das, man wirklich wissenschaftlich verantworten kann, und der politischen Aktivität.
Wie sieht denn Ihre Zwischenbilanz aus der Corona-Krise aus?
Jörg Phil Friedrich: Also Wissenschaft kann schon auch eine ganze Menge. Sie kann Szenarien berechnen und die können uns Orientierung darüber geben, worauf wir uns vorbereiten sollten. Und gerade, was den vorher angesprochenen Punkt der Dringlichkeit angeht, so hätte man mit den Szenarien, die uns geliefert wurden, über Wochen hinweg sehr konkret darauf vorbereiten können, die Schulen mit Lüftungsanlagen auszustatten oder die Altenheime pandemiesicherer zu machen. Also solche Dinge hätte man schon tun können.
Sorgen macht mir, dass wir im Moment gar nicht mehr darüber reden, dass das Demonstrationsrecht als politische Meinungsbegründung gerade ausgehebelt ist. Wir reden über Gaststätten, über Theater. Das sind Dinge, die auch für mich persönlich sehr wichtig sind.
Aber Demonstrieren ist ein ganz wichtiges Grundrecht und darüber wird nicht geredet. Dass die Regierung darüber nicht böse ist, ist klar. Denken Sie mal an Fridays for Future, wann haben wir da die letzten großen Demonstrationen gehabt?
Aber die Zahlen bei den Demonstrationen 2019 waren schon beeindruckend, und das hat die Diskussion zum Klimawandel ja auch vorangebracht. Davon sind wir heute weit entfernt.