Folgen der Bankenkrise: Energiepreise sinken wieder
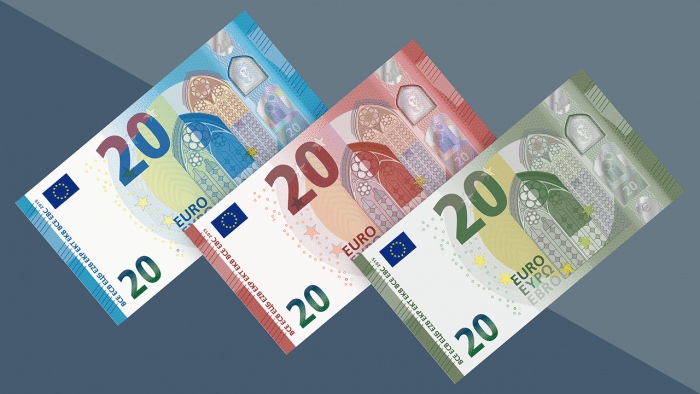
Gas und Öl sind derzeit deutlich günstiger als vor dem Ukraine-Krieg. Preissenkung erreicht private Endkunden aber kaum. Dafür wird die Inflation begünstigt – und einige wenige fahren Rekordgewinne ein.
Die Verwerfungen an den Finanzmärkten in der neuen, alten Bankenkrise führen zu starken Nachbeben auf anderen Märkten, die nur scheinbar nichts mit ihr zu tun haben.
Die Versuche der Europäische Zentralbank (EZB), einen Normalzustand zu simulieren, blieben bisher genauso wirkungslos wie die Bankenrettung der Credit Suisse (CS), mit der zwangsweise eine neue Mega-Bank entsteht. Damit werden die Probleme aber angesichts des enormen Umfangs der Bank nur noch größer. Denn fusioniert wurden zwangsweise Banken, die weltweit zu den 30 größten gehören.
Der neue Ausbruch der alten Krise zeigt vor allem, dass bei der Regulierung der Finanzmärkte und der Bankenaufsicht sowohl hier als auch in den USA versagt wurde. Über die Zwangsfusion der CS mit der UBS wurde nun eine Bank geschaffen, die zu groß sind, um pleitezugehen.
Die neue Bank ist mehr als doppelt so groß wie die jährliche Wirtschaftsleistung der Schweiz. Eigentlich, so isst uns stets erzählt worden, wollte man als Konsequenz der Finanzkrise doch Banken verschlanken, damit sie nicht mehr "too big to fail" sind und damit ein Systemrisiko darstellen.
Nervosität an den Finanzmärkten
Die Nervosität an den Finanzmärkten ist weiter enorm. Es gehen Gerüchte um, dass zum Beispiel allein in den USA mehr als 50 Banken vor Pleitegefahren stehen. Am Freitag gab es an den Börsen erneut Turbulenzen, der deutsche Leitindex Dax fiel in Frankfurt unter die Marke von 15.000 Punkte.
Vor allem die Deutsche Bank, die man vor einigen Jahren schon als Zombie-Bank gehandelt hatte, war besonders betroffen. Ihr Aktienkurs rauschte zeitweise um bis zu 15 Prozent in den Keller. Auch bei Commerzbank-Aktien kam es zu Panikverkäufen, die Papiere lagen zeitweise um zehn Prozent im Minus.
Die Angst vor weiteren Bankenpleiten geht um, da die Löcher in Bankbilanzen über die weiteren Leitzinserhöhungen größer werden. Dass die EZB nicht zurückhaltender als die US-Notenbank FED vorging, die die Leitzinsen am Donnerstag nur um 25 Basispunkte angehoben hat, rächt sich jetzt vermutlich schon in der Eurozone.
Schnell sind etwa die Kosten für Ausfallversicherungen, sogenannter Credit Default Swaps, für die Deutsche Bank in die Höhe geschnellt. Das war auch bei der Credit Suisse geschehen, kurz vor deren Pleite. Für die Absicherung eines zehn Millionen Euro schweren Pakets von Deutsche-Bank-Anleihen mussten am Freitag schon 173.000 statt 142.000 Euro gezahlt werden.
Demonstrativ sprach Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) der Bank sein Vertrauen aus. "Es gibt keinen Anlass, sich irgendwelche Gedanken zu machen", sagte Scholz am Freitag nach dem EU-Gipfel in Brüssel. Die Deutsche Bank habe ihr Geschäftsmodell grundlegend modernisiert, neu organisiert und "ist sehr profitabel".
Solche Beschwörungsformeln, das kennen wir aus der Finanzkrise ab 2008, zeigen eher, dass man sich Sorgen machen sollte. Scholz verstieg sich sogar zur Behauptung, das Bankensystem in Europa sei sehr stabil und widerstandsfähig. Die EU habe strenge Regeln für die Aufsicht etabliert. Genauso hatte er sich auch schon vor der Pleite der Credit Suisse geäußert.
Allseits ist klar, dass es mit der Regulierung nicht sonderlich weit her war, dass die Kapitalpuffer den Banken immer noch viel zu klein sind. Deshalb könnte sich alsbald herausstellen, dass es sich bei seinen Äußerungen schlicht um Beruhigungsrhetorik handelt.
Angst vor stärkerer Konjunkturflaute: Energiepreise fallen
Da die Angst umgeht, dass das Beben an den Finanzmärkten das Wachstum der Weltwirtschaft noch stärker belastet, als der Internationale Währungsfonds ohnehin erwartet, lässt die Preise von fossilen Brennstoffen purzeln, die eng mit dem Konjunkturzyklus verbunden sind.
Bricht die Konjunktur weiter ein – Deutschland könnte zum Quartalsende eine Rezession bescheinigt werden – geht natürlich auch die Nachfrage nach Öl und Gas zurück.
Die Ölpreise waren schon am Montag mit der Krise um die CS auf ein Fünfzehnmonatstief gefallen. Sie hatten sich zwar im Laufe der Woche wieder etwas erholt, gingen aber zum Wochenende wieder in den Keller.
Am Freitagmittag sank der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai um fast drei US-Dollar auf 72,94. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel ähnlich deutlich um 2,88 Dollar auf gut 67 US-Dollar.
Beim Gaspreis ist die Entwicklung noch deutlicher, was auch mit den sehr milden Temperaturen zu tun hat. Seit Jahresbeginn ist der Gaspreis in Europa schon um knapp 50 Prozent gefallen. Der als Referenz geltende Terminkontrakt TTF an der Energiebörse in den Niederlanden fiel am Montag sogar unter die Marke von 40 Euro pro Megawattstunde (MWh).
Er liegt nun weiter auf dem niedrigsten Stand seit Juli 2021, also deutlich vor Ausbruch des Ukraine-Kriegs. Der hatte den Erdgaspreis zum Teil auf mehr als 300 Euro explodieren lassen, nachdem das Gas längere Zeit um die 20 Euro je MWh gehandelt wurde.
Der Gaspreis hat wegen des absurden Tarifsystems (Merit-Order) in der EU auch die Strompreise explodieren lassen. Denn nach diesem System wird der Strompreis von der teuersten Art seiner Erzeugung diktiert.
Die billige Erzeugung über erneuerbare Energiequellen kam deshalb bei den Verbrauchern nie an und das soll auch so bleiben. An das besonders verbraucherfeindliche Merit-Order-System will die EU-Kommission nicht heran.
So werden die Strompreise genauso vergleichsweise hoch bleiben, wie auch die gefallenen Gas- und Ölpreise bestenfalls mit langer Verzögerung an die Verbraucher weitergegeben werden, weshalb sie auch weiterhin inflationstreibend wirken.
Ein Blick auf die Tankstellenpreise gibt darüber Aufschluss. Im Juli 2021, als die Rohölpreise auf einem ähnlichen Niveau wie jetzt lagen, zahlten Verbraucher in Deutschland am billigsten Tag (1. Juli) für Super E10 etwa 1,53 Euro im bundesweiten Durchschnitt. Am teuersten Tag mussten für Super E10 am 31. Juli durchschnittlich 1,57 Euro pro Liter gezahlt werden.
Für Diesel war der Preis im Durchschnitt am 18. Juli 2021 mit 1,40 Euro pro Liter am höchsten. Am 20. März 2022, also nach dem neuen Tiefstand in den letzten 15 Monaten, lag der Tagesdurchschnittspreis für Diesel an der Tankstelle bei 2,16 Euro, also 66 Cent teurer pro Liter. Super E10 lag bei 2,09 Euro pro Liter, also 52 Cent teurer.
Damit erklären sich die weiterhin enormen Gewinne der Mineralölfirmen, die auch stark inflationstreibend wirken. Telepolis hatte schon frühzeitig darauf hingewiesen, dass vor allem Gier und Spekulation für die hohen Spritpreise verantwortlich sein können.
Wir haben es in diversen Sektoren vor allem mit einer Gewinninflation zu tun, der Reallohnverluste der Bevölkerung entgegenstehen, wie man sie nie zuvor gesehen hat.
Die Verbraucher müssen warten
Auch die tiefen Gaspreise werden, das meint auch der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, erst mit deutlicher Verspätung mit sinkenden Preisen bei den Verbrauchern ankommen.
Es dürfte noch sechs bis zwölf Monate dauern, bis die Senkung der Großhandelspreise für Gas und Strom auch bei den Haushaltskunden ankommt.
Klaus Müller
Klaus Müller begründet das aber so: "Das liegt an der Laufzeit der Verträge und an der Einkaufsstrategie der Unternehmen."
Dass das etwas mit den enormen Gewinnen bei Energieversorgern zu tun, hat, will er offenbar nicht sehen. Dabei widerspricht er sich, wenn er auch erklärt. "So billig wie 2021 wird es allerdings nicht mehr werden." Warum nicht, wenn die Gaspreise nun so tief sind wie im Juli 2021?
"Wir müssen uns an höhere Preise gewöhnen, die Zeit der billigen Energie aus Russland ist endgültig vorbei", erklärt Müller. Wir sollen uns also damit abfinden, dass etwa der Shell-Konzern seinen Gewinn im zweiten Quartal 2022 auf 18 Milliarden US-Dollar verfünffacht hat.
Rekordgewinne der Ölkonzerne und neue Problemfelder
Im gesamten Jahr 2022 hat Europas größter Ölkonzern einen neuen Rekordgewinn erreicht. Der bereinigte Gewinn stieg auf 39,9 Milliarden Dollar, das ist in etwa das Doppelte des Vorjahres. Noch heftiger hat der Rivale ExxonMobil abgesahnt: "Der US-Ölmulti nahm im Jahresverlauf 55,7 Milliarden Dollar ein und steigerte sein Nettoergebnis damit gegenüber dem Vorjahr um rund 140 Prozent."
Wer also wirklich Inflation wirksam bekämpfen will, muss Spekulation wirksam bekämpfen und Zufallsgewinne abziehen und an die Verbraucher zurückführen. Denn die treiben die Inflation weiter an.
Die Kerninflation steigt munter weiter. Die Energiepreise sind aber längst wieder in den Keller gegangen.
Die Kerninflation ist in der Eurozone auf einem neuen Rekord von 5,6 Prozent angekommen. Die allgemeine Inflationsrate ist dagegen um 0,1 Prozentpunkte leicht gesunken. Sie ist aber mit 8,5 Prozent weiterhin unhaltbar hoch.
Dieser Ausflug ist deshalb bedeutsam, da die Notenbanken, die auf die starke Inflationsentwicklung lange nicht reagiert hatten, die Zinsen schließlich rasant in die Höhe treiben mussten, damit die Teuerung nicht völlig aus dem Ruder läuft.
Diese neue Notmaßnahme sorgt für neue Verwerfungen, reißt wieder neue Problemfelder auf. Denn die Zinserhöhungen führen letztlich wieder zu großen Löchern in den Bankbilanzen, wie sich im Fall der Silicon Valley Bank (SVB) schon deutlich gezeigt hat. Was da in den Bilanzen noch so alles an Verlusten schlummert, wird sich zeigen.
Es ist allseits bekannt, dass eine schnelle Anhebung von Leitzinsen irgendwo im Finanzsystem zu Problemen führt. Denn bei steigenden Zinssätzen verlieren ältere Staatsanleihen an Wert. Ihre Kurse sinken an den Geldmärkten. Banken machen enorme Verluste, wenn sie Anleihen frühzeitig verkaufen müssen, um Liquidität zu erhalten.
Das ist aber nicht nur ein Problem der SVB, dass sie sich mit Staatsanleihen vollgesaugt hat. Es waren die Notenbanken, die als Notmaßnahme die Geldmärkte seit der Finanzkrise ab 2008 geflutet haben, ganz besonders in der Corona-Krise, was die Grundlage für die hohe Inflation war. Diese Anleihen liegen nun zuhauf in den Tresoren der Banken und werden mit den steigenden Leitzinsen zum Problem.
Ein Notprogramm schafft neue Probleme, die mit neuen Notprogrammen "gelöst" werden sollen, womit die eigentlichen Probleme weiter verschärft werden. Hätte man mit der Zinsnormalisierung frühzeitig begonnen, als die Inflation deutlich die Zielmarke von zwei Prozent überschritt und wäre behutsam vorgegangen, um Zeit zur Anpassung zu geben, wäre das Schlimmste verhindert worden.
Der Fehler ist, dass man zu lange damit gewartet hat und jetzt forsch vorgehen muss. Der Grundfehler liegt allerdings darin, aus der Flutung der Geldmärkte einen Normalzustand gemacht zu haben, statt darin eine Notfallmaßnahme zu sehen, mit der man Zeit erkauft, um sie für Reformen zu nutzen.
Empfohlener redaktioneller Inhalt
Mit Ihrer Zustimmmung wird hier eine externe Buchempfehlung (Amazon Affiliates) geladen.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen (Amazon Affiliates) übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
