USA: Undokumentierte Flüchtlinge fürchten Massenabschiebungen
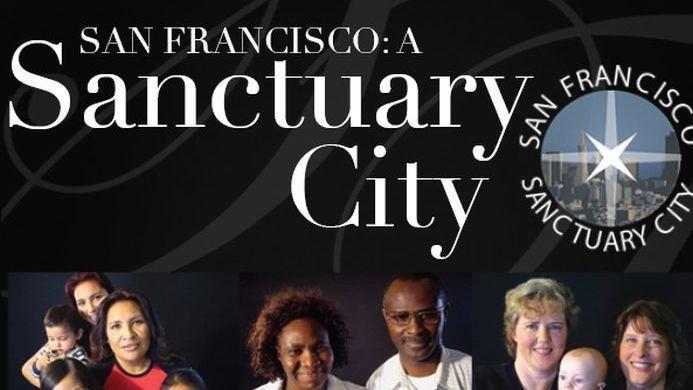
San Francisco hat sich bereits 1989 zu einer "sanctuary city" erklärt: Bild: sfgov.org
Die Zahl der "sanctuary cities", die Flüchtlinge dulden, ist gestiegen, Donald Trump will weiter schnell Millionen abschieben
In den Gemeinden und Vierteln mit Immigranten, besonders bei denen, die sich undokumentiert in den USA aufhalten, geht die Angst um. Trump hatte im Wahlkampf wiederholt einwandererfeindliche und antimuslimische Sprüche gerissen - Stichwort Mauerbau an der Grenze zu Mexiko, Massenabschiebungen und die Zwangsregistrierung von Muslimen. Jetzt, nach seinem Wahlsieg, bekräftigte er bei seinen "victory tours" durch mehrere Swing States, dass es ihm damit ernst ist.
Da undokumentierte Einwanderer zu den Schwächsten gehören, weil sie rechtlos sind, ist zu befürchten, dass sich die Trump-Regierung als eine der ersten Amtshandlungen an ihnen auslassen wird. Razzien, Festnahmen und Abschiebungen der Sündenböcke vor laufenden Kameras werden zum Fressen gehören, das Trump seinen Fans vorwirft. In welchem Ausmaß und ob das autoritäre Regime dabei Dammbrüche, etwa Razzien in Kirchen, Synagogen und Moscheen, oder offenen Verfassungsbruch begeht, ist eine offene Frage.
Angst geht bei den Immigranten allerdings nicht erst seit dem Wahlkampf und Trumps Wahlerfolg um. Denn die amtierende Obama-Regierung sorgte in den vergangenen acht Jahren für mehr Massenabschiebungen als ihre Vorgängerin, die Bush-Administration. Laut den letzten verfügbaren Regierungsabgaben waren es Ende 2014 mehr als 2,5 Millionen Abschiebungen - die Zahl dürfte inzwischen bei drei Millionen liegen.
Trotzdem ließ die Obama-Regierung Schlupflöcher offen. So wurden beispielsweise die für Zoll und Einwanderung zuständige Polizeibehörde ICE (Immigration and Customs Enforcement) angewiesen, an "sensiblen Orten", etwa bei Kirchen oder Beerdigungen, ein Auge zuzudrücken. 2012 ordnete Präsident Obama mit einer Direktive einen Abschiebestopp und zeitlich begrenzte Arbeitsgenehmigungen für Kinder von Undokumentierten an, eine Maßnahme, die 800.000 Menschen betrifft. Zudem besteht zwischen den Washingtoner Behörden und den Einzelstaaten beziehungsweise Kommunen ein rechtliches und politisches Spannungsverhältnis, das sich Hilfsorganisationen zunutze machen.
Trump schraubte seine Drohung im Wahlkampf, elf Millionen "Illegale" abzuschieben, nach dem Wahlsieg in einem Interview auf "zwischen drei und drei Millionen" herunter. Bis April 2017 werde er für die "Entfernung der mehr als zwei Millionen krimineller, illegaler Immigranten aus dem Land sorgen", heißt es in seinem 100-Tage-Programm. Weiter steht dort, der zweite Versuch, illegal in die USA einzureisen, werde mit einer Mindeststrafe von zwei Jahren Bundesgefängnis belegt. Wer beim dritten Mal erwischt wird oder in den USA vorbestraft war, soll mindestens fünf Jahre in einen Bundesknast.
Der Druck auf die "Illegalen" und der weiteren Millionen von Familienangehörigen, die sich rechtlich abgesichert in den USA befinden, aber um ihre Verwandten bangen, ist nicht neu, hat aber an Dringlichkeit gewonnen. Die zukünftige Rechtsaußen-Regierung wird die unter Obama entstandene Abschiebungsmaschinerie voll ausschöpfen. Noch bestehende Hürden will sie aus dem Weg räumen.
Wird Trump gegen "Sanctuary Cities" vorgehen, die nicht mit den Bundesbehörden kooperieren
Hilfsorganisationen, die sich für "Illegale" und ihre Familien einsetzen, können dabei auf einen reichen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Die "Sanctuary"-Bewegung entstand vor 34 Jahren in der Southside Presbyterian Church in Tucson im Bundesstaat Arizona. Deren Reverend John Fife hatte als erster angekündigt, seine Kirche würde Bürgerkriegsflüchtlingen aus El Salvador und Guatemala physischen Schutz gewähren. Denn da die Reagan-Regierung die Regime unterstützte, verweigerte sie den Flüchtlingen politisches Asyl. Im Verlauf von zehn Jahren bot die Kirche 13.000 Flüchtlingen Schutz. Über 500 weitere Kirchen- und Synagogengemeinden in den USA schlossen sich diesem Akt des zivilen Ungehorsams an.
Die unter Bush und mehr noch unter Obama agierende Schutzbewegung für Undokumentierte entwickelte daraus das Konzept der "sanctuary cities". Es geht dabei nicht mehr um zivilen Ungehorsam und bewussten Rechtsbruch wie Unterschlupf, Rechtsschutz, Nahrungsmittel- und medizinische Versorgung in Gotteshäuser, wie in den 80er Jahren. Vielmehr weisen Bürgermeister (wie die von New York, Los Angeles, San Francisco oder Chicago) ihre Polizei- und Gefängnisbehörden an, in punkto Abschiebungen mit den Bundesbehörden nicht zusammenzuarbeiten.
Zwei Beispiele: Eine lokale Gefängnisbehörde erhält von der Washingtoner Zoll- und Einwanderungsbehörde ICE die Bitte, einen inhaftierten Immigranten über den Freilassungstermin hinaus festzuhalten, um sie oder ihn abschieben zu können, kommt dieser Anfrage aber nicht nach. Oder ein örtlicher Polizeichef (oder Sheriff, das heißt Bezirkspolizeichef) weigert sich, seinen Untergebenen die Vollmachten für die Überprüfung des Immigrationsstatus, etwa bei einer Verkehrskontrolle, zu erteilen.
Für die Verweigerung der Zusammenarbeit mit den Bundesbehörden gibt es unterschiedliche Gründe. Manche Bürgermeister sind grundsätzlich aus humanitären und politischen Gründen gegen Massenabschiebungen. Andere verweisen auf die Rechtslage. Denn ein paar Bundesgerichte erklärten Inhaftierungen über den festgesetzten Freilassungstermin hinaus für verfassungsfeindlich. Schließlich befürchten örtliche Behörden, dass Festnahmen von "Illegalen" mögliche Zeugen abschreckt, die bei der Aufklärung von Straftaten behilflich sein könnten.
Die Zahl der "sanctuaries" wuchs von etwa 50 im Jahr 2012 auf fast 600 heute an. Und seit Trumps Wahl haben Tausende von US-Amerikanern ihre Bereitschaft bekundet, für mehr rechtliche Schutzräume zu sorgen. Prominente Fürsprecher waren die Bürgermeister von New York, Los Angeles, Chicago und San Francisco, die nach der Wahl ankündigten, den Status ihrer Städte beizubehalten.
Noch im Wahlkampf hatte Trump dagegen angekündigt, diesen Städten und Gemeinden deshalb die Bundesmittel zu entziehen - was Rechtsexperten für Verfassungsbruch halten, falls er seine Drohung in die Tat umzusetzen gedenkt. Denn ausgerechnet Republikaner-nahe Richter im Supreme Court hatten mehrmals in richtungsweisenden Urteilen die Macht der Bundesbehörden gegenüber den Einzelstaaten zurückgewiesen und letzteren eine relative Autonomie eingeräumt, etwa im Recht auf Waffenbesitz oder bei der Obamacare-Krankenversicherung.
Dass Trump und seine Rechtsberater trotzdem die Brechstange anlegen, ist wahrscheinlich. So wird es zu viel mehr Razzien, gerichtlichen Auseinandersetzungen - aber auch zu mehr Widerstand - kommen. Zuerst befürchten Hilfsorganisationen aber, dass schon im Januar ICE-Beamte als politisches Signal und als Drohung in "sanctuary cities" undokumentierte Menschen an ihren Arbeitsplätzen und zuhause mit Razzien überziehen. Rein rechtlich dürfen sie das. Die örtlichen Bürgervertretungen hätten dagegen keine rechtliche Handhabe.
Unterdessen formiert sich eine neue Sanctuary-Bewegung. Wahrscheinlich kann sie wegen der 35-jährigen Erfahrung aus den Zeiten von Reagan, Bush, Clinton, Bush Junior und Obama am meisten Widerstandspotential an den Tag legen. In Dutzenden von Gemeinden finden derzeit Versammlungen statt, in denen über Frühwarnsysteme beraten wird. Das geht von Trillerpfeifen über Nachbarschaftskomitees bis hin zur Einrichtung neuer "sanctuaries" und zur Evaluierung von Fluchtwegen aus ungesicherten Vierteln in sichere - oder gleich ganz über die Grenze nach Kanada.
