Wissenschaft und die Geschlechterunterschiede
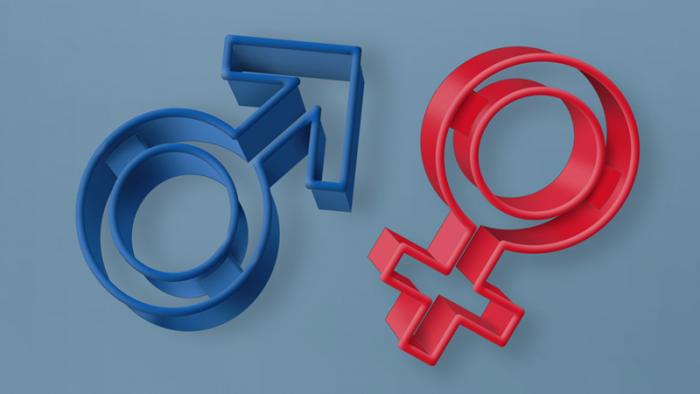
Der Streit um das Memo des Ex-Google-Mitarbeiters James Damore
Birgit Gärtner forderte hier vor kurzem neue Männer: "Sozial verträglich" müssten sie sein. Anlass dafür war das kontrovers diskutierte Papier über Gender-Diversität des ehemaligen Google-Mitarbeiters und IT-Experten James Damore (siehe Googeln Sie mal "von vorgestern", Mr. Damore).
Dieses wird seit Wochen in der internationalen wie deutschen Presse diskutiert. Sind die Thesen des jungen Mannes sexistisch oder rassistisch? War der Rauswurf angemessen? Oder ist die öffentliche Reaktion überzogen und ein Hinweis darauf, dass eine von Damores Grundthesen stimmt, dass nämlich mundtot gemacht werde, wer linke Geschlechterpolitik kritisiere? Im Folgenden will ich kurz auf einige der Thesen eingehen und diese mit der Kritik Gärtners vergleichen.
Biologisierung des Menschen
Der Autorin sind vor allem Hinweise auf biologische Unterschiede zwischen Frauen und Männern ein Dorn im Auge, mit denen die ungleiche Geschlechterverteilung in IT-Berufen und Führungspositionen erklärt wird. Es handelt sich also um einen Schluss vom Körper auf die Gesellschaft: Weil Frauenkörper angeblich so seien und Männerkörper anders, manifestierte sich der Zustand unserer sozialen Umwelt, mit all ihren Unterschieden. Der Status quo wird so als natürliche Ordnung dargestellt.
Es ist verständlich und berechtigt, dass Frau Gärtner solche Schlüsse kritisiert. Schließlich wurde Frauen im Laufe der Geschichte immer wieder vor Augen gehalten, sie könnten dieses oder jenes nicht, etwa studieren, weil ihnen dazu von Geburt an die nötige Intelligenz fehle. Besonders perfide war an diesem Denken, dass sich tatsächliche Unterschiede in der Intelligenz beispielsweise dadurch ergaben, dass Frauen in einer von Männern dominierten Welt Bildung vorenthalten wurde. Sie sollten besser auf Hausfrauen- oder Nähschulen gehen, um etwas "Nützliches" zu lernen - nützlich im Sinne der vorherrschenden Kultur.
Die Biologisierung von Geschlechterunterschieden ist also nachvollziehbarerweise ein rotes Tuch des Feminismus. Bloß, inwieweit mach sich der frühere Google-Mitarbeiter dieses Erklärungsansatzes schuldig?
Was James Damore eigentlich behauptete
Er stellt seinem Papier (hier die vollständige Fassung, veröffentlicht durch den Journalisten Mike Cernovich), zunächst einmal die Anmerkung voran, dass er für Diversität und Inklusion sei.
Tatsächlich vertritt er dann die These, dass Unterschiede zwischen Frauen und Männern in der Berufswelt zumindest teilweise mit biologischen Unterschieden zwischen den Geschlechtern zu tun haben könnten. Als mögliche Mechanismen nennt er vor allem den vorgeburtlichen Testosteronspiegel, die Erblichkeit von Persönlichkeitseigenschaften und die evolutionäre Vergangenheit des Menschen. Deshalb würden sich Männer tendenziell eher für Dinge, Frauen tendenziell eher für Menschen interessieren.
Ist diese Hypothese bereits sexistisch? Oder vielleicht das Ergebnis wissenschaftlicher Studien? In letzterem Falle würde man schlicht den Überbringer der Botschaft mit der Botschaft verwechseln.
Stand der Wissenschaft
Wenige Tage nachdem das Papier an die Öffentlichkeit gelangte, äußerten sich vier Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dazu. Beispielsweise kommentierte Geoffrey Miller, Assoziierter Professor für Evolutionspsychologie an der University of New Mexico:
Wie dem auch sei, ich denke, dass fast alle der empirischen Aussagen des Google-Memos wissenschaftlich korrekt sind. Darüber hinaus sind sie ziemlich vorsichtig und neutral wiedergegeben.
Geoffrey Miller
Die Wissenschaftsjournalistin und promovierte Neurowissenschaftlerin Debra W. Soh gab ihren Eindruck, wie folgt, wieder:
Als Frau, die in der akademischen Welt und in der IT-Branche gearbeitet hat, fand ich das Memo nicht in geringster Weise anstößig oder sexistisch. Ich fand das Dokument gut durchdacht, mit einem Aufruf für mehr Toleranz für verschiedene Meinungen und dazu, Menschen als Individuen zu behandeln und nicht auf Grundlage ihrer Gruppenzugehörigkeit.
Debra W. Soh
Schlechte Übersetzung
Wie verhält sich dies zum Aufschrei in den Medien und insbesondere Gärtners Kritik? Die Autorin hat schlicht eine Kernaussage falsch verstanden und übersetzt: Während Frau Gärtner behauptet, Damore glaube "fest an die Unterschiedlichkeit von Geschlechtern und Rassen", steht im Dokument: "Ich glaube fest an die Vielfalt der Geschlechter und Ethnien, und wir sollten nach mehr davon streben" (meine Übersetzung).
Im Papier steht eben nicht "differences", was man, wie die Autorin, rassistisch und sexistisch deuten könnte, sondern "diversity", Vielfalt. Förmlich die gesamte Gleichstellungspolitik spricht immer von Diversität, und zwar positiv. Dass Birgit Gärtner diese zentrale Stelle derart übersetzt hat, zeigt ein grundlegendes Missverständnis an.
Wissenschaft der Geschlechterunterschiede
Kommen wir noch einmal kurz zur wissenschaftlichen Grundlage: Das Thema ist zu umfangreich, um es hier vollständig zu diskutieren, und zudem mit der ewigen Debatte darüber verbunden, wie stark unsere Persönlichkeitseigenschaften angeboren oder angelernt sind. Ich bin ja bekannt als jemand, der simple biologisch/neurowissenschaftliche Erklärungen menschlichen Verhaltens kritisiert; erst kürzlich unterzog ich die molekularbiologische Psychiatrie und Erblichkeitsschätzungen einer Fundamentalkritik (ADHS und die Suche nach dem Heiligen Gral).
Damores Verweis auf den vorgeburtlichen Testosteronspiegel finde ich zu simpel; der Mann ist eben IT-Experte, kein Verhaltensbiologe oder Psychologe. Und ich stimme Gärtners Kritik an der Behauptung zu, kastrierte Männer, die als Frauen aufwachsen würden, nähmen später wieder eine männliche Identität an. Da Damore hier keine Quelle nennt, lässt sich dies nicht überprüfen.
Wie Geschlechtsidentität entsteht
Korrekt ist, dass geschlechtsangleichende Operationen, wie sie bis vor wenigen Jahrzehnten in undeutlichen Fällen bei Babys durchgeführt wurden, manchmal nach hinten losgingen: Nämlich insofern, als einige der Betroffenen sich im Erwachsenenalter gegen das ihnen per Seziermesser zugewiesene Geschlecht entschieden. Korrekt ist aber auch, dass der Sexologe John W. Money (1921-2006), der als Erster den Gender-Begriff prägte, der Geschlechtsidentität eine hohe Plastizität zumaß.
Gestützt auf Verhaltensuntersuchungen behauptete er, bis zum Alter von 18 Monaten lasse sich beinahe beliebig ein bestimmtes Geschlecht anerziehen. Das gilt heute zwar als überholt, dennoch war es schon in den 1950ern Stand der Forschung, dass neben sechs biologischen auch ein sozialer Faktor das Geschlecht prägt. Die heutige Genetik geht ebenfalls von einer Wechselwirkung von Genen und Umwelt aus. Manche lösen gar den binären Geschlechtsbegriff durch ein Spektrum der Geschlechter auf.
Mit Blick auf Geschlechtsunterschiede vor allem vom pränatalen Testosteron zu sprechen, wie Damore es tut, war also bereits vor rund 60 Jahren durch Forschung als unterkomplex entlarvt. Die Forschung der heutigen Zeit weiß es dann noch einmal besser.
"Weiße Machomännerkultur"
Wie gesagt, wenn man tief in die Forschung einsteigt, wird es schnell sehr kompliziert. Brigitte Gärtner diskutiert aber nicht nur die wissenschaftlichen Aspekte, sondern kritisiert auch die Kultur "weißer Männer". An dieser lässt sie kaum ein gutes Haar. Diese Exemplare der Spezies homo sapiens erzeugten eine giftige Umgebung - eine sogenannte "Toxic Masculinity" -, in der es Frauen besonders schwer hätten. Nebenbei: "weiß" und "männlich", sind das keine biologischen beziehungsweise ethnischen Kategorien? Soll Verhalten unter anderem Vorzeichen also vielleicht doch biologisiert werden, Frau Gärtner?
Gewundert habe ich mich über ihren Verweis auf Burschenschaften, Macho-Clubs und "Old-Boys-Networks". Wie viele Männer müssten denn in solchen Gruppierungen Mitglied sein, um korrekterweise von einer "männlichen Kultur" zu sprechen? Und wie viele sind es tatsächlich? Geht es hier nicht nur um eine Minderheit von Männern, die sich in dieser Form organisiert? Wo sind hier die Zahlen, um das Argument empirisch abzusichern?
Wie viele Männer gehen wohl ins "Blascafé"?
Die Kritik an einer Männerkultur kulminiert in dem Hinweis auf Cafés, in denen "Machertypen à la Damore" - bitte schauen Sie sich ihn einmal selbst an, zum Beispiel hier - "sich zum Espresso schnell mal einen blasen lassen können." Solche Etablissements, von denen ich übrigens noch nie etwas gehört habe, sprössen, so Gärtner, "wie Pilze aus dem Boden." Ich bin ihrer Quelle nachgegangen: Dort heißt es, es handle sich lediglich um ein Konzept für ein Café, also eine Geschäftsidee.
Davon abgesehen, was bewiese das Vorhandensein solcher Etablissements? Ich persönlich fühle mich von der Vorstellung, intimen Kontakt mit einem Menschen zu haben, mit dem man nicht spricht, den man nicht anfassen oder küssen darf, den man vielleicht noch nicht einmal sieht, angewidert. Darauf zu schließen, dies sei typisch männlich, wäre ähnlich falsch wie der Schluss, weil drei Frauen Probleme mit dem Einparken haben, könnten alle Frauen nicht einparken. Da hätten Feministinnen sicher etwas dagegen; zu Recht!
Weitere Fehldarstellungen
Ähnliche Einseitigkeiten ließen sich über ihre Darstellung gewalttätiger Männer - deren Opfer sind immerhin hauptsächlich Männer (Wer ist hier eigentlich das typische Opfer?) - oder des akademischen Werdegangs von Frauen sagen.
Maßnahmen der Frauenförderung etwa, wie sie seit vielen Jahren Akademikerinnen offen stehen, scheinen der Autorin völlig unbekannt zu sein. Auch das Geschlechterverhältnis über Aktivität in Sozialen Medien ist in ihrem Artikel verkehrt wiedergegeben. Frauen sind auf vielen dieser Plattformen aktiver als Männer.
Systematische Nachteile für Männer
An der Realität vorbei geht nach meiner Auffassung auch Gärtners Behauptung: "Frauen sind auf allen Ebenen benachteiligt." Zahlen über Schulabbrüche, Obdachlosigkeit, Gefängnisse, Selbstmorde, beruflich bedingte Todesfälle oder schlicht allgemein das durchschnittliche Lebensalter von Frauen und Männern (Für einen "Equal Age Day") erzählen eine andere Geschichte. Für viele Männer ist es selbstverständlich, beispielsweise bei der Feuerwehr, Polizei oder Bundeswehr, ihr Leben aufs Spiel zu setzen - und zwar sowohl für Frauen als auch für Männer. Das sollten meiner Meinung nach auch Feministinnen anerkennen.
Wer die Welt nur anhand der analytischen Kategorie "Geschlecht" verstehen will, der übersieht aber die Vielschichtigkeit unserer Gesellschaft. Je nach Herkunft, Bildung, Wohlstand, Aussehen und Gruppenzugehörigkeit äußern sich die Herausforderungen des Lebens auf sehr unterschiedliche Weise. Einen kurzen Einblick darin gewähren die Zahlen der Krankenhausaufenthalte für psychische Störungen.
Geschlecht und psychische Störungen
Männer sind demnach von alkoholbedingten Schwierigkeiten fast dreimal so häufig betroffen wie Frauen. Auch wegen Schizophrenien müssen sie deutlich häufiger ins Krankenhaus. Bei Frauen äußern sich psychische Probleme eher in Krankenhausaufenthalten wegen depressiver Episoden oder wiederkehrende depressiver Störungen.
Ob diese Unterschiede in der Biologie gründen, in der Sozialisation, in den unterschiedlichen Erfahrungen von Frauen und Männern in der Gesellschaft oder in der Art und Weise, wie Fachleute deren Probleme wahrnehmen und diagnostizieren, lässt sich schwer sagen. Es gibt nämlich kein objektives Kriterium für das Vorliegen dieser Störungen. Sie sind durch und durch normativ durchdrungen.
Wichtig ist aber, dass die Grafik anders aussehen würde, unterteilte man sie nicht nach Geschlecht, sondern beispielsweise nach Bildungsniveau, Wohlstandsniveau, Arbeitslosigkeit, Herkunftsland, Wohnumgebung (etwa: Land vs. Stadt), Beziehungsstatus oder Elternschaft (etwa: allein- vs. gemeinsam erziehend). All solche Faktoren können auf unterschiedliche Weise zu Problemen und Stress führen, die wiederum die psychische Gesundheit beeinflussen.
Redeverbot für Männer
Vielleicht wäre Männlichkeit etwas weniger "toxisch", dürften Männer offen über ihre Erfahrungen sprechen. Wenn sie es dennoch versuchen, wird ihnen schnell von Feministinnen über den Mund gefahren, wie es vor kurzem der Dokumentarfilm "The Red Pill" der Amerikanerin Cassie Jaye zeigte.
Birgit Gärtner bestätigt in diesem Zusammenhang sogar Damores Thesen, wo sie ihm unterstellt, dass er sich in "Medien ausweinte." Genau diese Haltung gegenüber Männern in Schwierigkeiten hat der junge IT-Experte in seiner zehnten Fußnote zitiert:
Der Gedanke, dass Männer Unterstützung brauchen, passt nicht gut in das Traditionelle Geschlechtssystem. Von Männern wird erwartet, dass sie stark sind, sich nicht beschweren und Probleme selbst lösen. Probleme von Männern werden wegen unserer geschlechtlichen Vorstellungen von Akteurschaft häufiger als persönliches Scheitern gesehen, nicht in einer Opferrolle. Das entmutigt Männer, Aufmerksamkeit auf ihre Probleme zu lenken (seien sie individuell oder für die ganze Gruppe), weil sie Angst davor haben, als Jammerlappen, Kläger oder schwach angesehen zu werden.
James Damore
Sind Frauen doch anders als Männer?
Ich will zum Ende kommen und zeigen, wie die Autorin die Thesen von James Damore, die sie als sexistisch und rassistisch verurteilt, schließlich sogar selbst stützt. Dies geschieht, wo sie die Erfahrungen von Management-Coach Inge Bell zitiert, die etwa beschreibt: "Ja, es fällt unglaublich vielen Frauen schwer, sich und das eigene Können 'gut zu verkaufen'. Aus voller Inbrunst an sich zu glauben, stolz zu sein auf sich und die eigenen Leistungen, und das alles auch nach draußen zu tragen - nach dem Motto 'Tue Gutes und rede darüber' - das ist den meisten Frauen gar nicht erst in die Wiege gelegt worden."
Das hört sich doch verdächtig nach James Damore an, wenn er schreibt: "Unterschiede in der Verteilung von Persönlichkeitseigenschaften (engl. traits) zwischen Männern und Frauen könnten teilweise erklären, warum nicht 50% der Angestellten in Tech-Berufen oder Führungspositionen Frauen sind".
Dieser musste sich in Interviews der Frage stellen, ob er Frauen, die in IT-Berufe wollten, mit seiner Biologisierung nicht den Wind aus den Segeln nähme. Die Darstellung angeblicher Schwierigkeiten von Frauen von Inge Bell könnte aber ähnlich demotivierend wirken.
Verhältnismäßigkeit der Kündigung
Es wurde wenig darüber gesprochen, ob Damores Kündigung überhaupt verhältnismäßig war. Nach meinem Dafürhalten wäre die Maßnahme angemessen, wenn der Mitarbeiter die internen Praktiken seines Arbeitgebers veröffentlicht hätte. Dadurch ist Google jetzt ein Image-Schaden entstanden. Da nach wie vor aber nicht klar ist, wie das für das Firmennetz bestimmte Papier an die Öffentlichkeit gelangte, lässt sich die Frage zurzeit nicht abschließend beantworten.
Ob sich Google damit aber nicht ins eigene Fleisch geschnitten hat, steht auf einem anderen Blatt. Schließlich kritisierte der IT-Experte ja gerade die mangelnde Offenheit bei dem Internetkonzern, die sich nun in der Kündigung manifestiert; und obendrein haben die Rechten jetzt einen neuen Helden zur Untermauerung ihrer Kritik, dass politische Korrektheit zur Unterdrückung anderer Meinungen missbraucht würde.
Herausforderungen äußern sich im Leben von Frauen und Männern - oder schlicht von Menschen - auf unterschiedliche Weise und ebenfalls vermittelt durch Kategorien wie Wohlstand, Bildung und Herkunft. Das ist seit Jahrzehnten Konsens der Sozialwissenschaften und Genderforschung. Immer weiter Öl ins Feuer zu gießen, hilft weder Frauen noch Männern. Damore hat auch nicht in allem Recht, doch er hat sich immerhin die Mühe gemacht, seine Thesen wissenschaftlich zu begründen und nicht nur ideologisch.
Hinweis: Dieser Artikel erscheint ebenfalls im Blog "Menschen-Bilder" des Autors.
