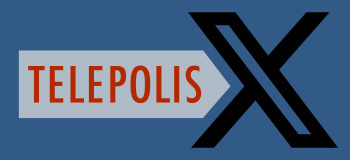Droht mit der AfD ein neues 1933 – oder nur Deutschland à la Meloni?
Seite 2: Orbán und Meloni sind die Vorbilder der modernen Rechten
- Droht mit der AfD ein neues 1933 – oder nur Deutschland à la Meloni?
- Orbán und Meloni sind die Vorbilder der modernen Rechten
- Auf einer Seite lesen
Wer immer die Folie von 1933 aufmalt, wird sich schnell daran gewöhnen, wenn die AfD oder andere Ultrarechte tatsächlich mit an die Regierung kommen. Denn dann wird beruhigt festgestellt, dass sie keine Konzentrationslager errichten. Das konnte man in Italien sehen. Dort übernahm vor einem Jahr mit Giorgia Meloni eine Politikerin die Regierungsmacht, die sich offen positiv auf den Mussolini-Faschismus bezogen hatte. Anfangs war die Aufregung groß – verflogen ist sie aber schnell.
Denn Meloni steht zur Nato, bleibt in Sachen Ukraine-Krieg auf dem Kurs des globalen Westens und macht Politik im Rahmen der EU. Damit kann sie ihre rechte Agenda besser umsetzen, als der krawallige Chef der Lega, Matteo Salvini. Dabei wird innenpolitisch auf vielen Ebenen die rechte Agenda geräuschlos umgesetzt.
Lesen Sie auch:
Kann EU-Kritik nur rechts sein?
In Deutschland warnen inzwischen Ultrarechte im Umfeld des Instituts für Staatspolitik um Götz Kubitschek und Ellen Kositza vor einer "Melonisierung" der Rechten. Gemeint ist damit eine Politik der Rechten, die auf einen langsamen Umbau des Staates und nicht auf einen abrupten Bruch setzt. Mit dieser Linie ist Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán so erfolgreich, dass man schon von einem erfolgreichen rechtsautoritären Staatsumbau sprechen kann.
Orbán ist damit nicht nur bei Rechten jeder Couleur, sondern auch bei Konzernvertretern aller Länder, auch aus Deutschland, sehr beliebt. Denn ein rechtsautoritärer Staat bringt auch große Vorteile für die Profitsteigerung der Konzerne. Darüber können auch die Regenbogenfahnen und Diversitätsdiskurse nicht hinwegtäuschen, mit denen große Teile der Wirtschaft heute ihre Wokeness zeigen. Damit ist es schnell vorbei, wenn sich eine rechte Bewegung dauerhaft eine Basis sichern kann.
Wer einen Machtzuwachs der zeitgenössischen Rechten kritisieren will, sollte die Strategien einer Meloni in Italien oder eines Orbán in Ungarn genau studieren, statt ständig vor einen neuen 1933 warnen. Diese notwendige Kritik an einer zu stark am historischen Antifaschismus orientierten Linken legitimiert nicht jene Sozialkonservativen, die vom Antifaschismus nun gar nichts mehr hören wollen.
Davon konnte man sich kürzlich bei der Vorstellung des Buches "Die (Selbst)Zerstörung der deutschen Linken" von Sven Brajer im Berliner Sprechsaal überzeugen. Der Autor übernahm fast alle Begriffe, warnte vor einer Verwestlichung der Linken, vor transatlantischen Eliten, lehnt Regenbogenfahnen und auch die Klimabewegung ab.
In dieser Melange rechter und rechtsoffener Thesen gehen auch die wenigen Beispiele unter, mit denen Brajer präzise argumentiert. Der Höhepunkt des Trauerspiels war die Frage aus dem Publikum, ob sich der Autor in Zukunft eine Koalition zwischen einer noch zu gründenden "Wagenknecht-Partei" und der AfD vorstellen kann.
Eigentlich hätte man denken können, dass Brajer diese Frage empört zurückweist, weil doch nur Böswillige Sahra Wagenknecht so etwas unterstellen würden. Doch das war nicht der Fall – der Autor sah nur keine große Chance auf ein solches Bündnis, weil heute ein Bernd Lucke oder eine Frauke Petry nicht mehr in der AfD sind.
Dabei fiel weder dem Referenten noch dem Publikum der Widerspruch auf, dass da lang und breit moniert wurde, die Linkspartei und auch die gesellschaftliche Linke würde keine Politik mehr im Interesse der Mehrheit der Bevölkerung machen. Und dann wird die Idee eines Bündnisses mit der AfD, einer Partei des Eigentümerblocks, die besonders vehement die Rechte von Arbeitern und Erwerbslosen aushebeln will, nicht empört zurückgewiesen.
Da stellt sich auch schnell heraus, dass mit der Mehrheit der Bevölkerung, die angeblich von Linken kaum noch vertreten wird, keineswegs die schlecht bezahlte Putzkraft und die Erwerbslosen gemeint sind, sondern der deutsche Mittelstand. Bündnisse mit der AfD sind in diesem sozialkonservativen Milieu durchaus denkbar. Sie sind aber keine Querfront, weil es keine Linken in dieser Kooperation gibt.
Weder Volks- noch Querfront
Das Erfreulichste an der Veranstaltung war noch, dass ein mit Wagenknecht sympathisiertet Gewerkschafter ernüchtert feststellte, dass hier deutsche Mittelstandsförderung als linke Politik verkauft wird. Er bekam jedoch keine Antwort auf seine Frage, welche Position eine mögliche Wagenknecht-Partei zu Arbeitskämpfen hat.
Solche enttäuschten Sozialkonservativen wären durchaus für eine Linke zu gewinnen, die tatsächlich auf soziale Kämpfe von unten setzt. Doch viele Antifaschisten sehen eher in der bürgerlichen Zivilgesellschaft Bündnispartner. Das wäre eine Neuauflage der Volksfront mit einer äußerst schwachen Linken im Schlepptau der Liberalen.
Präzise Kritik an diesem Konzept leistete am Donnerstagabend in Berlin ein Referent auf einer Veranstaltung der Freunde der Klassenlosen Gesellschaft. Dort wurde aus dem Publikum betont, dass soziale Kämpfe, ob am Arbeitsplatz, im Stadtteil oder am Jobcenter, eigentlich das beste Mittel gegen das Anwachsen der Rechten sind.
Doch gerade, als es interessant wurde, brachen die Veranstalter die Diskussion ab. Denn auch sie orientieren sich an Antifaschismus-Konzepten von dissidenten Linken. Auch die Kritiker von stalinistischen Volksfront-Konzepten blicken auf die heutige Rechte durch die Brille historischer Faschismus-Konzepte.
Ein Kritiker monierte, auf der Veranstaltung sei die Diskussion über den Nationalsozialismus aus dem Umfeld der "Frankfurter Schule" ebenso ausgeblendet worden, wie Texte von Wilhelm Reich und Erich Fromm. Vielleicht wäre es Zeit für einen großen Kongress, auf dem ich Antifaschisten aus verschiedenen Ländern darüber austauschen, ob der Aufstieg der AfD und FPÖ sowie die Regierungen von Orban bis Meloni mit den Faschismus-Analysen der 1930er-Jahre erklärt werden können, welchen Stellenwert die Erklärungsmuster der Frankfurter Schule haben – und ob es nicht aktuellere Erklärungsansätze für den Aufstieg der Rechten heute gibt.