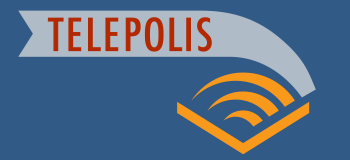Nato will Schnelle Eingreiftruppe auf über 300.000 aufstocken
Seite 2: Vor der Rekrutierungsoffensive
- Nato will Schnelle Eingreiftruppe auf über 300.000 aufstocken
- Vor der Rekrutierungsoffensive
- Auf einer Seite lesen
Völlig unklar ist, woher das Personal für den deutschen Anteil an der drastisch ausgebauten NRF kommen wird. Laut "Mittelfristiger Personalplanung" soll die Bundeswehr von aktuell rund 180.000 Soldat:innen auf knapp 200.000 bis 2025 anwachsen, das dürfte aber "nur" ausreichen, um der Nato den bis zu diesem Zeitpunkt zugesagten voll ausgestatteten ("kaltstartfähigen") Divisionsgroßverband (ungefähr 15 - 20.000 Soldat:innen) dauerhaft zur Verfügung stellen zu können.
Aktuell ist sie hierzu allenfalls über kurze Zeiträume in der Lage, aber angesichts der neuen NRF-Pläne müsste Deutschland hier wohl sogar noch einmal kräftig nachlegen. Auch herzu existieren unterschiedliche Angaben, aber die Bundeswehr schreibt, aktuell stelle sie mit 13.700 Soldat:innen rund ein Drittel der derzeitigen Nato Response Force.
Nun lässt sich dieser Anteil nicht eins zu eins auf eine dann sechsstellige NRF übertragen, da der deutsche Anteil nicht immer so hoch wie derzeit ist. Wie hoch er tatsächlich sein wird, steht aktuell noch in den Sternen, legt man aber zum Beispiel den Nato-Finanzierungsschlüssel an, so beläuft sich der deutsche Anteil dort auf 16,34 Prozent, was umgerechnet in NRF-SoldatInnen rund 50.000 bedeuten würde.
Am Ende mögen es weniger werden, es ist aber davon auszugehen, dass der deutsche Anteil deutlich über der bislang als Maß aller Dinge erachteten Division im Jahre 2025 liegen dürfte. Dies dürfte die Bundeswehr vor mindestens zwei Probleme stellen: Einmal hat die Truppe schon derzeit ihre Liebe Müh und Not, an genug Rekruten zu gelangen, um ihre Zahl konstant zu halten. Es ist völlig unklar, wie sie den geplanten Aufwuchs um 20.000 Soldat:innen, ganz zu schweigen von dem zusätzlichen Personal, das die NRF-Aufstockung erfordern wird, bewerkstelligen will.
Eine massive Rekrutierungskampagne ist praktisch vorprogrammiert, ob diese aber "Erfolg" haben wird, ist durchaus fraglich. So wurde unlängst über sinkende Zahlen von Bewerbungen seit Beginn des Ukraine-Krieges ebenso berichtet wie auch darüber, dass sich seither die Zahl derjenigen, die aus der Bundeswehr ausscheiden würden, gegenüber dem Vorjahreszeitraum verdoppelt habe.
Fass ohne Boden
Die zweite Frage, vor der (nicht nur) die Bundeswehr absehbar stehen dürfte wird sein, woher das Material und besonders das Geld für die zusätzlichen Truppen kommen soll. Schon jetzt wird in der militärnahen Presse gewarnt, das Bundeswehr-Sondervermögen von 100 Milliarden Euro mit dem in den nächsten fünf Jahren Ausgaben von zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes erreicht werden, würde hier nicht ausreichen:
Schon die bis jetzt vom Baltikum bis Ungarn aufgestellten Battlegroups brachten die Nato-Partner mit Ausnahme der USA an die Grenzen ihrer Möglichkeiten. Schwere Waffensysteme, Munition und gut trainierte Gefechtsverbände größerer Dimension sind nicht nur in der Bundeswehr Mangelware. Neben einem Gipfelbeschluss wird es viel Geld und dauerhaften politischen Willen benötigen, den Worten des strategischen Konzepts die Hardware folgen zu lassen.
Die Welt, 28.6.2022
Auch diesem Problem widmete sich Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in seiner gestrigen Pressekonferenz, der zunächst die drastischen Ausgabenerhöhungen der letzten Jahre lobte. Und tatsächlich veröffentlichte die Nato ebenfalls gestern neue Zahlen, denen zufolge die Militärhaushalte der Mitgliedsländer von 895 Milliarden Dollar (2015) auf 1.190 Milliarden Dollar (2022) gestiegen sind.
Laut Stoltenberg würden inzwischen neun Nato-Mitgliedstaaten zwei oder mehr Prozent in ihr Militär investieren, 19 weitere hätten angekündigt, diesen Wert bis 2024 erreichen zu wollen. Doch auch das scheint nicht mehr genug: Obwohl Militär und Rüstungsindustrie vor nicht allzu langer Zeit nicht nur hierzulande von Ausgaben in Höhe von zwei Prozent des BIP nur hätten träumen können, gab Stoltenberg nun die neue Devise aus, diese zwei Prozent seien nunmehr nur noch "ein Boden, keine Decke".