Was uns die Corona-Krise lehrt
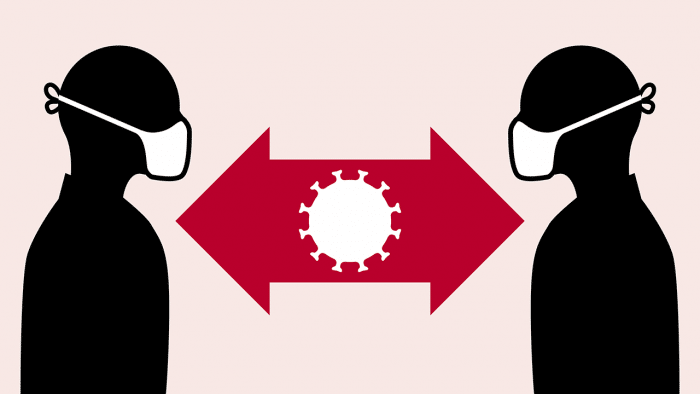
- Was uns die Corona-Krise lehrt
- Ländervergleich: Was haben die Maßnahmen in Deutschland gebracht?
- Auf einer Seite lesen
Die Pandemie ist womöglich bald unter Kontrolle. Nach zwei Jahren Krisenpolitik bleiben aber einige Fragen
Als im April 2020 die Heinsberg-Studie von Professor Hendrik Streeck (Universität Bonn) publiziert wurde, dauerte es nicht lange, bis erste Kritik an der Studie geübt wurde. Die besonnene Art von Streeck, die eigentlich Wissenschaftler auszeichnen sollte, passte nicht in die aufgewühlte Atmosphäre und den Angstszenarien, die schon bald kommuniziert wurden.
Die Studie selbst wurde nicht wirklich zur Kenntnis genommen; diesen Eindruck konnte man gewinnen. Denn aus der Studie ließen sich fünf Punkte extrahieren: (1) Wenn viele Menschen, (2) über mehrere Stunden, (3) dicht beieinander, (4) in einem geschlossenen Raum, (5) sprechend und singend zusammensitzen, dann ist die Gefahr sehr hoch, dass man sich mit Corona ansteckt.
Dass man aus dieser Erkenntnis nicht strikt weitere methodische Untersuchungen angesetzt hat (es hätte die Aufgabe des Robert-Koch-Instituts, RKI, sein können), führte dazu, dass der Lockdown als einzige Methode praktiziert wurde.
Interessant wäre nun zum Beispiel zu wissen, wie das Infektionsgeschehen ist, wenn Menschen (4) nicht in einem geschlossenen Raum zusammensitzen. Wie ist dann die Ansteckung? Wie sähe es aus, wenn die Menschen weiter auseinander sitzen? Diese und weitere Fragen bleiben offen.
Man hätte logischer und methodischer vorgehen sollen, um herauszufinden, wo die Ansteckungswege sind, was man im Prinzip bis heute nicht genau weiß. Wie viele Ansteckungen gab es beispielsweise in Discountern und Supermärkten, die ja für die Versorgung der Bevölkerung unerlässlich waren und im Prinzip immer offen waren? Wie die Gefährdung bei Fußballspielen unter freien Himmel, mit vollen Stadien und mit weniger Fans?
Dass man das nicht gewagt hat, hängt mit der Suggestion zusammen, dass wir die Menschen vor Corona retten können, und zwar fast alle: durch die Methode Lockdown. Das ist aber genauso unmöglich, wie alle Menschen vor einer Influenza zu retten, an der in den vergangenen zirka drei Jahrzehnten bis zu 200.000 Menschen gestorben sein könnten (das wurde nie so genau gemessen wie jetzt bei Corona).
Allein die Hongkong-Grippe 1968 bis 1970, an die sich niemand erinnert hat, kostete allein in Deutschland 40.000 Menschen das Leben, vielleicht noch mehr, hätte man genauer nachgeforscht. Ein Intensivmediziner hat dem Autor dieser Zeilen mitgeteilt, dass damals (unter wesentlich schlechteren instrumentellen und medizinischen Bedingungen) die Intensivstationen wahrscheinlich genauso überlastet waren, wie heute bei Corona, nur dass es weder die Politik noch die Medien besonders thematisiert hatten. Es stellt sich die Frage, warum wir heute grundsätzlich anders handeln. Offenbar hat sich unser Verhältnis zum Tod wesentlich geändert. Was wir darauf folgern, hat Auswirkungen auf die Zukunft.
Wir wissen auch viel zu wenig, wie das Geschehen in den Krankenhäusern bzw. den Intensivstationen tatsächlich aussieht. Es gibt beispielsweise keine statistische Zeitreihe der Diagnosen und Behandlungen etc. auf den Intensivstationen. Auch die Statistiken der Krankenhäuser sind äußerst dürftig. Somit musste man sich darauf verlassen, was einzelne Intensivmediziner öffentlich sagten.
Zwei Jahre Schreckensszenarien
Häufig wurden Szenarien von Tausenden von Toten kommuniziert. Die Folge war viel Angst in der Bevölkerung, was auch dazu führte, dass Menschen nicht zur Krebsvorsorge gingen, weil sie befürchteten, sich mit Corona anzustecken. Noch Ende des vergangenen Jahres warnte der Virologe Christian Drosten vor weiteren Hunderttausend Coronatoten, wie auch Frank Ulrich Montgomery, der dem Rat des Weltärztebundes angehört – er fürchtete sogar eine ebolagleiche Variante und den Tod Hunderttausender allein in Deutschland.
Solche unbesonnenen Vorhersagen sollte ein wissenschaftlich ausgebildeter Mediziner vermeiden. Es sollte nur das sagen, was er wirklich beweisen kann.
Virologen wurden zu Medienstars, wie auch theoretische Physiker und Mathematiker, und häufig zu Diskussionsrunden in den Medien eingeladen, prägten dort die Meinungen und Ängste der Bürger als so genannte ausgewiesene Experten, wie der bis dahin weithin unbekannte SPD-Politiker Karl Lauterbach, der dank seiner ständigen Präsenz in den öffentlich-rechtlichen Medien, besonders des WDR, von der Öffentlichkeit als der Experten schlechthin sich entwickeln konnte und mit dem Gesundheitsministerium belohnt wurde.
Das Parlament, die Vertretung der deutschen Bürger, musste sich erst langsam sein Recht zurückerobern, um die Entscheidungen zur Corona-Politik nicht nur Virologen und anderen Experten zu überlassen, die immer nur ein Rezept hatten: den Lockdown, der mittlerweile kritisiert wird, ob er wirklich so effizient war. Auf jeden Fall folgten anfangs fast alle Politiker im Wesentlichen Christian Drosten und Karl Lauterbach.
Virologen und andere Ärzte entwickelten sich darüber hinaus nicht nur zu Experten ihres Fachgebietes, sondern ihre Expertise wirkte sich auch auf die Sozialpsychologie, die Soziologie, Pädagogik wie Ökonomik aus, obwohl sie darin keine Fachkenntnis haben.
In seinem Buch The Death of Expertise kritisierte Tom Nichols, dass Experten hin und wieder über die Grenzen ihres Fachgebietes Meinungen äußern, was ihnen eigentlich nicht zusteht, sie aber davon ausgehen, sie könnten das.
Erst in den vergangenen Monaten wird klarer, dass wir erhebliche Kollateralschäden haben, die bisher nicht berücksichtigt worden waren, weil die Dominanz der Virologen und Ärzte kaum andere Sichtweisen zuließen. Vor allem sind wieder einmal Kinder und Jugendliche die Leidtragenden.