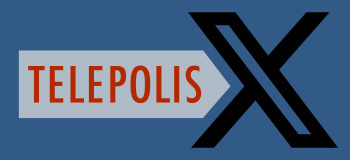Claudia Roth und die preußischen Nebelkerzen
Seite 2: Aufruhr in Berlin: Wie es zum Eklat um den Preußischen Kulturbesitz kam
- Claudia Roth und die preußischen Nebelkerzen
- Aufruhr in Berlin: Wie es zum Eklat um den Preußischen Kulturbesitz kam
- Auf einer Seite lesen
Natürlich geht es in der Politik auch um Symbolik. Zum Beispiel beim Thema Koalitionsausschuss, das medial schwer zu vermitteln ist. Da gewinnt, wer die beste Formulierung, die eingängigste Metapher wählt. Dass sich politische Gestaltung aber nicht darin erschöpfen darf, zeigt jetzt ein Skandal um die Stiftung Preußischer Kulturbesitz in Berlin, zu dem Telepolis am Donnerstag den ersten Bericht einer gemeinsamen Recherche mit der Berliner Zeitung veröffentlicht.
Zu der Stiftung mit rund 2.000 Mitarbeitern gehört neben der Staatsbibliothek und anderen Einrichtungen auch das Landesmuseum zu Berlin mit 15 Sammlungen und 4,7 Millionen Objekten an 19 Standorten.
Im vergangenen Dezember hat sich die zuständige Kulturstaatsministerin Claudias Roth (Grüne) des Themas angenommen - auf ihre Weise. Roth kündigte an, die Stiftung mit Preußen im Namen umzubenennen. "Was haben Andy Warhol und Joseph Beuys mit Preußen zu tun?", sagte sie dem Spiegel.
Die seit zweieinhalb Jahren überfällige "umfassende Strukturreform, die den einzelnen Einrichtungen jetzt mehr Autonomie und Handlungsfähigkeit gibt", schien für sie eine untergeordnete Rolle zu spielen. Aber der Name! Von Potsdam bis nach Königsberg, mag man da anfügen, vollbringt die Roth so stolz ihr Werk."
Zumal der Vorstoß kein Zufall zu sein schien. Fast zeitgleich hatte Roth ihre Parteifreundin und Außenministerin Annalena Baerbock mit der Anweisung in die Schlagzeilen gebracht, einen nach Otto von Bismarck benannten Raum im Auswärtigen Amt in "Saal der Deutschen Einheit" umzubenennen. Linke und Grüne applaudierten, AfD und FDP ärgerten sich, man war in den Schlagzeilen. Ende, aus.
Aber war da nicht noch etwas? Der Wissenschaftsrat, ebenfalls 1957 gegründet und damit genauso alt wie die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, war in seinem Urteil eigentlich eindeutig. Die Stiftung als gemeinsame Dach- und Verwaltungsstruktur für die Kultureinrichtungen der Bundeshauptstadt sei "dysfunktional". Und: "Inzwischen überwiegen die Hemmnisse einer gemeinsamen Dachstruktur deren Nutzen für die Einrichtungen und deren Leistungsfähigkeit. Eine "strukturelle Überforderung" der Stiftung sei deutlich geworden, so dass "die Einrichtungen der SPK teilweise den Anschluss an aktuelle Entwicklungen und Debatten zu verlieren" drohten.
Dass es zweieinhalb Jahre dauert, bis auf dieses vernichtende Urteil reagiert wird, ist das eine. Dass der Verantwortliche für das konstatierte Versagen, Stiftungspräsident Hermann Parzinger, nun versucht, sich selbst und ihm nahestehende Führungspersönlichkeiten an die Spitze eines Umbaus zu stellen, der erst durch seine Versäumnisse notwendig geworden ist, muss innerhalb der Berliner Kulturinstitutionen zu Recht als Skandal empfunden werden.
Bewusst oder unbewusst hat Claudia Roth mit ihrem medienwirksamen Umbenennungsvorschlag eine Nebenkerze gezündet. Und Parzinger, dem der Druck des Wissenschaftsratsberichts im Nacken saß, nutzte die Chance dankbar. Ob und wie dieses mutmaßliche Manöver zwischen Roth und Parzinger abgestimmt war, wird zu klären sein.
Der Stiftungsskandal zeigt auch ein wenig das Versagen der Medien. Als Roth ihre Namensdebatte über den Spiegel vom Zaun brach, fragte niemand ernsthaft nach. Weder die Interviewer noch die zahlreichen Medien, die das Thema aufgriffen. Sie alle hatten den Bericht des Wissenschaftsrates bereits vergessen. So konnte Roth den Reformauftrag gegenüber der Deutschen Presse-Agentur einfach ins Gegenteil verkehren: "Jetzt gibt es (...) ein ganz klares Votum, dass es ein Verbund bleiben soll, also ein Haus mit einem großen Dach, aber in dem die Räume eigentlich sehr frei zu gestalten sind."
Von wem dieses Votum kam, sagte sie nicht. Von den Mitarbeitern der Museen und Forschungseinrichtungen unter dem Dach der Stiftung wohl nicht, wie Telepolis heute berichtete. Sie haben ein klares Votum gegen den klammheimlichen Umbau der Berliner Kulturinstitutionen abgegeben, den Parzinger umzusetzen versucht. Telepolis hat den Fall am Donnerstag gemeinsam mit der Berliner Zeitung öffentlich gemacht, heute geht es weiter.
Artikel zum Thema:
Bernd Müller: Exklusiv: Namensstreit um Stiftung Preußischer Kulturbesitz wohl Ablenkungsmanöver
Peter Grassmann: Die dunkle Seite von Otto von Bismarck
Alexa Weyrauch-Pung: Kehrt Nofretete zurück nach Ägypten?
Empfohlener redaktioneller Inhalt
Mit Ihrer Zustimmung wird hier eine externe Buchempfehlung (Amazon Affiliates) geladen.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen (Amazon Affiliates) übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.