Corona: Vorsorge weiblich, Sterben männlich
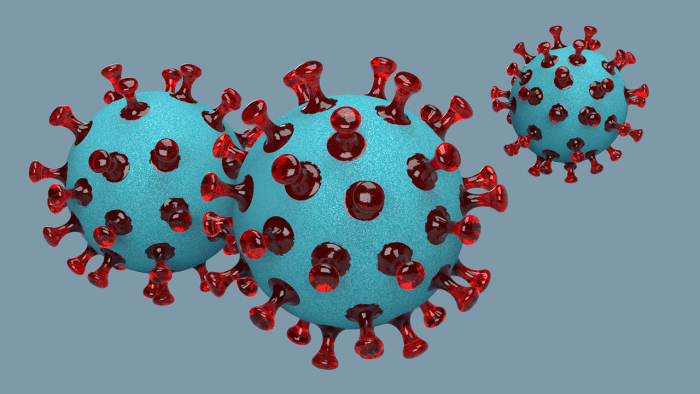
Es sterben deutlich mehr Männer an Covid-19 als Frauen. Das ist zum Teil genetisch bedingt, liegt aber andererseits am "unmännlichen" Image der Gesundheitsvorsorge und an Rollenklischees
Die Corona-Pandemie ist - auch - eine Geschlechterfrage, denn es sterben weitaus mehr Männer als Frauen in Verbindung mit Covid-19, während bei Frauen mehr Verdachtsfälle auf schwere Nebenwirkungen von Impfstoffen auftreten. Beides spiegelt Erkenntnisse der geschlechtsbasierten Gesundheitsforschung wider. Lösungen wären eine gendersensible Gesundheitserziehung für Jungen und Männer und stärkere Berücksichtigung der weiblichen Biologie bei der Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen.
Grundsätzlich ist und bleibt Covid-19 eine zum Teil schwerwiegende Viruserkrankung, an der zu leiden - oder gar zu sterben - niemand persönlich Schuld hat. Insofern geht es nicht um die Klärung einer Schuldfrage, sondern um ein besseres Verständnis der Auswirkungen der Pandemie, auch der für die subjektive Gesundheit sowie Infektions-Prophylaxe. Dabei fällt die stärkere Betroffenheit von Männern unter den offiziell als in Verbindung mit Covid-19 Verstorbenen registrierten Personen ins Auge. Laut RKI sind gilt als "in Verbindung mit Covid-19 verstorben", wer mittels PCR-Test positiv auf Sars-Cov-2 getestet wurde.
"Generell liegt es immer im Ermessen des Gesundheitsamtes, ob ein (PCR-bestätigter) Fall als verstorben an bzw. mit COVID-19 ans RKI übermittelt wird oder nicht. Bei einem Großteil der an das RKI übermittelten COVID-19-Todesfälle wird "verstorben an der gemeldeten Krankheit" angegeben", erklärte das Robert-Koch-Institut (RKI) auf Telepolis-Anfrage. Bei Personen, die zuhause behandelt werden und sterben, und zwar nicht aufgrund der Diagnose Covid-19, entscheidet der Hausarzt, ob ein PCR-Test durchgeführt wird, das kann während der Behandlung, aber auch post mortem geschehen.
Klassen-, Alters- und Geschlechterfrage
Wer ein Problem lösen will, muss es zunächst einmal analysieren. Covid-19 wirkt in vielfacher Hinsicht wie ein Brennglas auf soziale Probleme, aber es fördert auch die unterschiedliche Betroffenheit von Männern und Frauen zutage. Das entspricht in etwa den wissenschaftlichen Erkenntnissen bezüglich des Unterschieds bezüglich Frauen- bzw. Männergesundheit. Bislang scheint es allerdings nicht so, als würden diese Erkenntnisse im Rahmen der Pandemiebekämpfung eine Rolle spielen. Das Robert-Koch-Institut wäre indes gut beraten, die selbst zusammengetragenen Ergebnisse zu beachten.
Die Corona-Pandemie sei eine Klassenfrage, keine Altersfrage, konstatierte kürzlich Peter Nowak. Das stimmt - und stimmt auch nicht, denn einerseits sind sozial Benachteiligte von der Pandemie stärker betroffen, andererseits sterben auch unter den Armen vor allem die alten Menschen. Immer noch, obwohl mittlerweile 70 Prozent der über 80jährigen vollständig gegen Corona geimpft sind, wie das RKI gegenüber Telepolis mitteilte.
Dem täglichen Lagebericht des RKI zufolge starben während des Berichtszeitraums vom 31. März 2021 bis zum 4. Mai 2021 insgesamt 7.380 Menschen offiziell in Verbindung mit Covid-19. Davon waren 3.757 über 80 Jahre alt, das entspricht 51 Prozent der insgesamt in diesem Zeitraum Verstorbenen; 928 waren über 90 Jahre alt, das entspricht 13 Prozent der insgesamt in diesem Zeitraum Verstorbenen.
Männer unter Covid-19-Verstorbenen deutlich überrepräsentiert
Von den zu dem Zeitpunkt registrierten 83.359 offiziellen Covid-19-Toten waren 43.399 (52 Prozent) männlich und 39.960 (48 Prozent) weiblich. Das wirkt relativ ausgeglichen. In der Gesamtschau kommt zum Tragen, dass in der Altersklasse der über 90-jährigen mit 12.172 zu 6.278 fast doppelt so viele Frauen wie Männer unter den Toten registriert wurden. Dieses Alter erreichen allerdings auch deutlich mehr Frauen als Männer.
In der Gruppe der 80- bis 89-jährigen verstarben 19.543 Männer und 18.979 Frauen in Verbindung mit dem Virus. Mit insgesamt 56.972 stellen die über 80-jährigen 68 Prozent der Verstorbenen (Stand 4. Mai 2021 laut RKI) insgesamt. Schon bei den 70- bis 79jährigen waren deutlich mehr Männer von tödlichen Covid-19-Verläufen betroffen als Frauen: 10.712 Männer und 6.034 Frauen.
Mit 73.718 verstorbenen Frauen und Männern beträgt der Anteil der über 70-jährigen insgesamt 88 Prozent. Von den 60- bis 69-jährigen starben 5.068 Männer und 2.205 Frauen offiziell in Verbindung mit Covid-19, im Alter von 50 bis 59 Jahren waren es 1.837 Männer und 755 Frauen, bei den 40- bis 49-jährigen 386 Männer und 188 Frauen, bei den unter 40-jährigen waren es 185 Männer bzw. Jungen, und 95 Frauen, bzw. Mädchen.
In Deutschland sind zur Zeit 5.681.135 Menschen über 80 Jahre alt, davon sind 3.517.261 bzw. 62 Prozent weiblich und 2.163.874 bzw. 38 Prozent männlich. Trotzdem lag die Sterberate (offiziell in Verbindung mit Covid-19 Verstorbene) der Männer über der der Frauen: 45,3 Verstorbenen über 80 waren männlich, 54,7 weiblich - bezogen auf alle über 80jährigen lag die Sterberate der Frauen bei 0,88 Prozent und bei gleichaltrigen Männern bei 1,2 Prozent. Folglich sind selbst unter den Toten in dieser Altersgruppe Männer in Bezug zu ihrem Bevölkerungsanteil überrepräsentiert.
Schwere Impfkomplikationen vor allem bei Frauen
Dem "Sicherheitsbericht" des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI)zufolge wurden vom 27.12.2020 bis zum 30. April 2021 "28.774.580 Impfungen durchgeführt, davon 21.329.667 Impfungen mit Comirnaty, 1.667.261 Impfungen mit dem Covid-19-Impfstoff Moderna, 5.775.546 Impfungen mit Vaxzevria und 2.106 Impfungen mit dem Covid-19-Impfstoff Janssen". Comirnaty ist der Impfstoff von BioNTech/Pfizer, Vaxzevria das von AstraZeneca entwickelte Vakzin.
Dem Institut wurden 49.961 Verdachtsfälle von unerwünschten Impfreaktionen gemeldet, davon 4.916 schwere unerwünschte Impfreaktionen. Als "unerwünschte Reaktionen" werden unter anderem Schmerzen an der Impfstelle, Schwellungen, Übelkeit, Müdigkeit, grippeähnliche Symptome bis hin zu Tachykardie (Herzrhythmusstörungen) genannt. Als "unerwünschte schwerwiegende Reaktionen" gelten laut PEI "solche, bei denen die Personen im Krankenhaus behandelt werden oder Reaktionen, die als medizinisch bedeutsam eingeordnet wurden."
In rund 75 Prozent aller Fälle waren von solchen Nebenwirkungen Frauen betroffen. Das wird unter anderem damit erklärt, dass neben der priorisierten Altersgruppe der über 80-jährigen mit deutlichem Frauenüberschuss vorwiegend Frauen in Pflegeberufen geimpft wurden.
Das PEI registrierte in 527 Fällen den Tod der betreffenden geimpften Person "in unterschiedlichem zeitlichen Abstand zur Impfung". Bei der "überwiegenden Mehrzahl der verstorbenen Personen" bestanden dem Institut zufolge "multiple Vorerkrankungen, wie z. B. Karzinome, Niereninsuffizienz, Herzerkrankungen und arteriosklerotische Veränderungen, die vermutlich todesursächlich waren." Mit anderen Worten: Schwerstkranke wurden geimpft und starben, weil ihre Lebenszeit aufgrund ihrer Erkrankung stark begrenzt und ihr baldiger Tod zu erwarten war, oder möglicherweise, weil ihr geschwächter Körper mit der Belastung durch die Impfung nicht mehr fertig wurde.
297 Menschen über 80 Jahre verstarben laut PEI nach der Vergabe des BioNTech/Pfizer-Impfstoffs Corminaty, der zunächst als einziges Vakzin eingesetzt wurde, da Vaxzevria von AstraZeneca nicht für Personen über 65 Jahre freigegeben wurde. Der Ständigen Impfkommission (Stiko) zufolge lagen für Wirkung und Nebenwirkung bei älteren Menschen nicht ausreichend Daten vor. In 67 Fällen trat nach der Impfung eine Thrombose mit Thrombozytopenie (TTS) auf, bei 50 Frauen und 17 Männern.
In 14 Fällen führte dies zum Tod, bei fünf Männern und neun Frauen. In 14 Fällen - 12 Frauen und zwei Männer - waren die Betroffenen über 60 Jahre alt, 2 Frauen und ein Mann über 60 verstarben. Die TTS wurde laut PEI "post mortem in der Autopsie festgestellt". Allen Betroffenen wurde der AstraZeneca-Impfstoff Vaxzevria verabreicht. Ein Zusammenhang der Erkrankung und den Todesfällen mit dem Impfstoff wird ungern zugegeben. Im Fall einer 32jährigen wurde dieser allerdings zweifelsfrei durch eine Obduktion bestätigt. Dass es einen solchen Zusammenhang auch in anderen Fällen geben könnte, erscheint dadurch nicht abwegig.
Die Stiko empfahl unterdessen, das Vakzin nur noch an Personen über 60 Jahre zu verimpfen. Da in etwa genauso viele 60- bis 70jährige Frauen betroffen sind wie 50- bis 60-jährige oder 40-50-jährige, erschließt sich diese Empfehlung nicht: In der Altersgruppe 40 bis 49 Jahre waren zehn Frauen betroffen, in der Altersgruppe 50 bis 59 Jahre elf Frauen, in der Altersgruppe 60 bis 69 zehn Frauen sowie in allen drei Altersgruppe jeweils ein Mann, sieben Männer waren zwischen 30 und 39, fünf zwischen 20 und 29 Jahre alt. Die neun verstorbenen Frauen waren einem Fall zwischen 30 und 39, in vier Fällen zwischen 40 und 49, in zwei Fällen zwischen 50 und 59, in einem Fall zwischen 60 und 69 sowie in einem Fall zwischen 70 und 79 Jahre alt.
Von den fünf verstorbenen Männern war einer zwischen 20 und 29, drei waren zwischen 30 und 39 sowie einer über 70 Jahre alt. Mittlerweile haben verschiedene Bundesländer die Priorisierung für den AstraZeneca-Impfstoff aufgehoben, und es kann sich damit impfen lassen, wer möchte. Daraufhin ist eine Diskussion entbrannt, ob ältere Menschen, die sich impfen lassen möchten, sich nicht freiwillig für Vaxzevria entscheiden könnten, um die anderen Vakzine den Jüngeren zu überlassen. Da die Gefährdung ganz offensichtlich weit über das 60. Lebensjahr hinausgeht, entbehrt diese Diskussion jeglicher Grundlage.
Der kleine Unterschied: Das zweite X-Chromosom
Wie bereits erwähnt weist das PEI daraufhin, dass - zumindest zu Beginn der Impfkampagne - deutlich mehr Frauen geimpft wurden als Männer und es von daher häufiger bei Frauen zu unerwünschten Reaktionen gekommen sei. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Allerdings ist aus der geschlechtsbasierten Medizinforschung bekannt, dass es auch genetische Unterschiede zwischen Frauen und Männern gibt. In der Studie "Impact of sex and gender on COVID-19-outcomes in Europe" (Einfluss von biologischem Geschlecht und sozialem Geschlecht auf die Covid-19-Ergebnisse in Europa), in der die unterschiedliche Betroffenheit von Frauen und Männern in China sowie verschiedenen europäischen Staaten untersucht wird, geben die Autorinnen und Autoren eine andere Erklärung:
Die angeborene Erkennung und Reaktion auf Viren sowie die nachgeschalteten adaptiven Immunantworten während Virusinfektionen unterscheiden sich zwischen Frauen und Männern. Die Anzahl und Aktivität angeborener Immunzellen, (…), sind im Allgemeinen höher als bei Männern. (…)
Die Immunantworten auf Viren können mit Veränderungen der Sexualhormonkonzentrationen variieren, die natürlicherweise während des Menstruationszyklus nach Empfängnisverhütung, nach der Menopause und während der Hormonersatztherapie (HRT) sowie während der Schwangerschaft beobachtet werden.
Das erklärt zum einen, warum sehr viel mehr Männer von schweren Verläufen und betroffen sind und häufiger daran versterben als Frauen, hat der Studie zufolge aber beispielsweise auch Auswirkungen im Hinblick auf Impfungen:
In Bezug auf adaptive Immunantworten zeigen Frauen im Allgemeinen stärkere humorale und zellvermittelte Immunantworten auf Antigenstimulation, Impfung und Infektion als Männer. Sowohl die Grundwerte von Immunglobulinen als auch die Antikörperreaktionen sind bei Frauen durchweg höher als bei Männern.
Immunglobulinen beschreibt das Gesundheitsportal netdoktor.de als "Eiweißstrukturen, die zum spezifischen Immunsystem gehören. Spezifisch bedeutet, dass sie gezielt bestimmte Bestandteile eines Krankheitserregers erkennen, binden und bekämpfen können."
Kurz zusammengefasst: Frauen haben einen höheren natürlichen Schutz gegen Virusinfektionen und reagieren deshalb heftiger auf entsprechende Impfstoffe. Ob diese Erkenntnis in die Produktion der Impfstoffe einfloss, ist indes nicht bekannt. In der Studie ist von einem "signifikanten Unterschied" zwischen den Geschlechtern die Rede. Frauen zeigten eine höhere Aktivität der cytotoxischen T-Zellen. Diese spielen eine tragende Rolle bei der primären Abwehr von Viren und anderen Krankheitserregern und sind in der Lage, Zellen abzutöten. Deshalb werden sie auch "Killerzellen" genannt und gelten als unser Immungedächtnis.
Laut einem Bericht des Deutschlandfunk (DLF) im August 2020 wurde in der Forschung bereits diskutiert, ob T-Zellen auch Monate nach einer Infektion die Immunabwehr gegen Sars-Cov-2-Viren ankurbeln können, auch wenn im Blut keine Antikörper mehr nachweisbar sind. "Beim Sars-CoV-1, dem Vorgänger-Virus des neuartigen Coronavirus, blieben diese T-Zellen bei den Betroffenen auch Jahre nach der Infektion ständig in Bereitschaft", hieß es im DLF.
Laut RKI waren "spezifische T-Zellen … auch dann nachweisbar, wenn keine Antikörper mehr gefunden werden - egal wie leicht oder schwer die Krankheit verlaufen ist. Das bedeutet: Die T-Zellen machen Hoffnung auf dauerhafte Immunität auch bei leichten Verläufen." Nach einem Dreivierteljahr stellt sich die Frage, warum dieser Erkenntnis nicht mehr Beachtung geschenkt und zunächst einmal breitflächig auf T-Zellen-Immunität getestet wurde und wird. Eine solche Breitenuntersuchung wäre mit hohen Kosten verbunden, die jedoch weit unter denen der durch den Lockdown entstandenen liegen dürften - und unter den durch Impfschäden bedingten. Von den Auswirkungen auf die Patientinnen und Patienten mal ganz abgesehen.
Zunächst zwei Drittel der registrierten Covid-19-Toten männlich
Auch die Pharmazeutische Zeitung befasste sich mit der höheren Männersterblichkeit aufgrund von Covid-19-Erkrankungen. Laut RKI waren in Deutschland bis Juli 2020 zwei Drittel der Verstorbenen männlich. Dieses Verhältnis hat sich inzwischen geändert, wie bereits erwähnt, weil inzwischen sehr viele sehr alte Menschen offiziell als in Verbindung mit Covid-19 verstorben gelten, unter den hochbetagten mehrheitlich Frauen. In dem Artikel wird dieses Phänomen erklärt:
Eine Vermutung ist, dass das Immunsystem beim vermeintlich schwächeren Geschlecht bis zu den Wechseljahren aktiver und stärker ist. Aus Sicht der Evolution ergibt das Sinn, sollen doch Frauen das ungeborene und neugeborene Leben schützen.
Der berüchtigte "Männerschnupfen" ist keine reine Wehleidigkeit
Das zweite X-Chromosom macht den kleinen, aber feinen - und im Falle von Covid-19 im wahrsten Sinne des Wortes existenziellen - Unterschied:
Wenn es um genetische Unterschiede bei Männern und Frauen geht, ist in der Regel von den X- und Y-Chromosomen die Rede. Frauen haben zwei X-Chromosomen, Männer ein X- und ein Y-Chromosom. Viele Gene, die das Immunsystem regulieren, liegen ausschließlich auf dem X-Chromosom. Der alte Glaube, dass das zweite X-Chromosom bei Frauen komplett inaktiv ist, ist mittlerweile widerlegt. Heute weiß man, dass Immunzellen bei Frauen Gene auf beiden X-Chromosomen ablesen können. Dadurch steht ihnen ein vielfältigeres Spektrum an Abwehrmechanismen zur Verfügung, was die effektivere Reaktion des weiblichen Immunsystems erklären könnte. Zudem kann bei Frauen der Ausfall von einem Gen auf einem der beiden X-Chromosomen kompensiert werden, indem die Information vom anderen herangezogen wird.
Bei dem deutlich kleineren Y-Chromosom des Mannes ist vor allem die Sex determining Region of Y-Gen (SRY), also die das Geschlecht bestimmende Region, relevant. Sie ist unter anderem für die verstärkte Produktion von Testosteron verantwortlich. Frauen verfügen über weniger Testosteron, dafür über mehr Estrogen. Die männlichen und weiblichen Geschlechtshormone wirken sich unterschiedlich auf das Abwehrsystem aus. Estrogen stimuliert die Immunantwort und regt die Vermehrung von spezifischen Abwehrzellen an. Dieser Effekt ist allerdings abhängig von der Konzentration von Estrogen im Körper und unterliegt zyklusbedingten Schwankungen. Testosteron wirkt supprimierend auf das Immunsystem.
Das bedeutet unter anderem, dass der berühmt-berüchtigte "Männerschnupfen" keine reine Wehleidigkeit ist, sondern Männer tatsächlich stärker leiden. Die genetische Wirkung lässt indes im Alter nach, was in Hinsicht auf die Evolution logisch erscheint und die hohe weibliche Todesrate bei den über 80jährigen erklärt. Sie haben diesen biologischen Schutz schlicht nicht mehr. In dem Text wird ebenfalls darauf hingewiesen, dass Frauen stärker auf Impfungen reagieren - und häufiger zu Autoimmunerkrankungen neigen als Männer. Die möglicherweise durch den AstraZeneca-Impfstoff Vaxzevria ausgelöste Thrombozytopenie ist eine Autoimmunkrankheit. Da stellt sich die Frage, ob die vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse bei der Entwicklung der Impfstoffe berücksichtigt wurden.
Man(n) muss mehr auf seine Gesundheit achten
Der biologische Unterschied zwischen den Geschlechtern ist die eine Seite der Medaille, die andere das soziale Verhalten und die Lebensbedingungen. Beides wird ebenfalls als ursächlich für die angeschlagene Männergesundheit angegeben. Genannt werden objektive Bedingungen, etwa unterschiedlich risikoreiche Berufe, mehr Männer, die Auto fahren, Männer werden häufiger Opfer von gewalttätigen Angriffen, was Auswirkungen sowohl auf die physische als auch die psychische Gesundheit hat; aber auch subjektives Verhalten wie beispielsweise Unachtsamkeit im Hinblick auf die eigene Gesundheit und mangelndes Hygieneverhalten.
Das gilt generell, im Hinblick auf Corona ist aber zu beachten, dass vor allem Frauen in Pflegeberufen tätig und somit einem hohen Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind. Bei Männern schlägt sich nieder, dass sie weniger auf ihre Gesundheit achten und erziehungsbedingt Schmerzen eher ignorieren, statt ärztlichen Rat einzuholen. Ein "echter Indianer" kennt eben keinen Schmerz, haben viele von ihnen als kleine Jungen zu hören bekommen. Eine frühe Diagnose und eine umgehende medizinische Behandlung sind aber sowohl entscheidend für den Verlauf von Vorerkrankungen als auch für den Verlauf einer Covid-19-Erkrankung.
Im RKI-Bericht "Gesundheitliche Lage der Männer in Deutschland" von 2014 wird darauf hingewiesen, dass Frauengesundheit bereits seit dem Jahr 2000 Thema sei. 2001 habe es den ersten Frauengesundheits-Bericht des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) gegeben, die Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern haben das Thema 2008 aufgegriffen, gefolgt von Bayern, Berlin und Schleswig-Holstein. Erst 2010 wurde das Thema Männergesundheit aufgegriffen.
In der geschlechtsbasierten Medizinforschung wird zwischen Sex und Gender unterschieden, Sex meint das biologische Geschlecht, Gender die daraus konstruierte soziale Rolle, die beispielsweise entscheidenden Einfluss auf die Berufswahl hat. Aber eben auch auf das Selbstbild: Im Falle der Männer bedeutet dies, schon als Junge das Gefühl vermittelt zu bekommen, immer stark sein, immer funktionieren, Gefühle wie körperlichen Schmerz unterdrücken zu müssen. Die "Stiftung Männergesundheit" konstatiert dazu:
Gesundheit spielt für viele Männer eine untergeordnete Rolle. Sie missachten häufig körperliche Warnsignale, und der Gang zum Arzt wird als Eingeständnis von Schwäche gewertet. Männer nehmen Gesundheitsrisiken in Kauf, um ihrer Rolle im Beruf und Privatleben gerecht zu werden. Ernste Erkrankungen werden daher häufig erst spät, nicht selten zu spät, festgestellt.
Ausgehend von der kürzeren durchschnittlichen Lebenserwartung von Männern betrieb das RKI auf dieser Grundlage sozusagen Ursachenforschung. Dabei wird unterschieden zwischen der mittleren, der fernen sowie der gesunden Lebenserwartung. Die mittlere Lebenserwartung beschreibt die durchschnittliche Lebenserwartung; die fernere die ab einem bestimmten Alter, häufig wird dabei der Eintritt ins Rentenalter zugrunde gelegt; bei der gesunden Lebenserwartung wird der aktuelle Gesundheitszustand, etwaige chronische Erkrankungen, etc. mit einbezogen.
Das Ergebnis: Sex - also das biologische Geschlecht - kostet die Männer vermutlich durchschnittlich ein Lebensjahr, der Rest ist auf die Lebensumstände sowie das Sozialverhalten zurückzuführen. Die Annahme, die biologischen Unterschiede seien lediglich für ein Jahr kürzere durchschnittliche Lebenserwartung verantwortlich, ist indes keine gesicherte medizinische Erkenntnis, da sie auf eine im dem Bericht erwähnte Studie zurückgeht, bei der bei einer Langzeitstudie Nonnen und Mönche beobachtet wurden.
Es wurde vorausgesetzt, dass beide eine ähnliche Lebensführung haben dürften und insofern eine vergleichbare Gruppe seien. Inwieweit das zwar puristische, dennoch relativ geschützte Leben in einem Kloster mit dem in unserer hektischen Arbeitswelt verglichen werden kann, sei mal dahingestellt.
2014, als der RKI-Bericht erstellt wurde, betrug der Unterschied in der durchschnittlichen Lebenserwartung zwischen Frauen und Männern fünf Jahre. Sehr viel stärker - und hier kommt die Feststellung von Peter Nowak, Covid-19 ist eine Klassenfrage, die auf Gesundheit allgemein übertragen werden kann zum tragen - ist der Unterschied in der Lebenserwartung aufgrund der sozialen Lage:
Die Differenz zwischen höchster und niedrigster Einkommensgruppe betrug bei den Männern 10,8 Jahre. Auch bei der ferneren Lebenserwartung ab 65 Jahren waren die Unterschiede zwischen den beiden Einkommensgruppen sichtbar (Differenz 7,4 Jahre). Ein deutlicher Unterschied zwischen höchster und niedrigster Einkommensgruppe konnte auch für die gesunde Lebenserwartung belegt werden, der mit 14,3 Jahren sogar noch stärker ausfällt.
Auch hier zeigen sich Frauen widerstandsfähiger als Männer: Soziale Benachteiligung wirkt sich nicht gleich stark auf die durchschnittliche Lebenserwartung aus. Grundsätzlich aber ist das Krebsrisiko, das Risiko für einen tödlichen Herzinfarkt, für Unfall und für Suizid bei Männern im Schnitt deutlich höher als bei den Frauen. Vorerkrankungen wie Krebs, Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind häufig die Ursache für schwere Verläufe bei COVID-19 oder gar daran zu versterben.
Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) stellt zudem "geschlechtsspezifische Unterschiede auch bei psychischen Erkrankungen" fest:
Zwar werden starke Stressbelastungen oder Depressionen bei Männern in Deutschland seltener diagnostiziert als bei Frauen, doch rund drei Viertel aller vollendeten Suizide entfallen auf Männer. Fast jeder 50. Todesfall eines Mannes ist eine Selbsttötung. Leistungsdruck, ständige Erreichbarkeit und soziale Krisen sind häufige Ursachen dafür.
Neben den objektiven Bedingungen ist "subjektives Risikoverhalten" laut RKI maßgeblich entscheidend:
Ein Teil der Mortalitätsunterschiede zwischen Männern und Frauen kann auf gesundheitliches Risikoverhalten zurückgeführt werden. Die alkoholische Leberkrankheit infolge von Alkoholabusus, Lungenkrebs als Folge von Rauchen und HerzKreislauf-Erkrankungen als mögliche Folge eines ungesunden Lebensstils hinsichtlich Ernährung, Bewegung, Übergewicht sowie Tabakkonsum sind bei Männern relevante Todesursachen. Hinzu kommen ein größeres Risiko, durch Verkehrsunfälle zu sterben sowie die häufigere Erwerbstätigkeit von Männern und die damit einhergehenden gesundheitlichen Gefährdungen. Der bestehende Geschlechterunterschied bei den Todesursachen wird dabei, wie die Lebenserwartung, durch Verknüpfung verschiedener sozialer und verhältnisbedingter Faktoren beeinflusst.
Genannt werden auch Ursachen wie die Vernachlässigung einfachster, aber grundlegendster Hygienestandards wie beispielsweise Händewaschen.
Auf die Partnerinnen kommt es an
Das RKI stellt in seinem Bericht fest, dass Männer von festen Partnerschaften auch im Hinblick auf ihre Gesundheit profitieren:
Neben den Risiken sind aber auch Ressourcen identifiziert worden, die sich positiv auf den Gesundheitszustand und damit wiederum auf das Sterblichkeitsgeschehen auswirken. So konnte bei der Frage nach dem möglichen Einfluss des Familienstandes auf die Sterblichkeit ein protektiver Effekt von Ehe bzw. Partnerschaften nachgewiesen werden.(…)
Auffällig ist zudem, dass die Sterblichkeitsunterschiede zwischen Verheirateten und Nichtverheirateten bei den Männern größer sind, als dies bei den Frauen der Fall ist. Demnach scheinen Männer hinsichtlich der Sterblichkeit in größerem Maße von der Ehe/Partnerschaft zu profitieren als Frauen.
Auch das wird mit Gender erklärt, nämlich mit der vielfach üblichen Rollenverteilung in Beziehungen:
Als eine Erklärung wird diskutiert, dass überwiegend Frauen für gesundheitliche Belange innerhalb von Ehen und Partnerschaften verantwortlich sind. Gesundheitliche Themen haben einen engen Bezug zu weiblichen Rollenmodellen. Insbesondere in eher traditionell geführten Partnerschaften sind überwiegend Frauen für gesundheitliche Belange verantwortlich. Sie agieren als Vorbilder für die Kinder, vermitteln gesundheitliches Wissen und Einstellungen, stellen die Rahmenbedingungen und Regeln für ein gesundheitsförderliches Verhalten auf und bilden die Schnittstelle zum professionellen Gesundheitssystem.
Daher scheinen Frauen auch einen positiven Einfluss auf das Gesundheitsverhalten ihrer Partner zu haben. Im Falle einer Trennung zeigt sich dementsprechend, dass Männer sich relativ stark auf diese Ressource verlassen. Nach einem Beziehungsende leben sie häufig gesundheitlich riskanter als während der Partnerschaft.
Gesundheitsvorsorge häppchenweise servieren?
Was folgt daraus? Zunächst einmal im Hinblick auf die Frauen, dass die unterschiedliche weibliche Biologie bei der Entwicklung von Medikamenten stärker berücksichtigt werden müssen. Die Corona-Vakzine, insbesondere der Impfstoff von AstraZeneca, scheinen für Frauen nicht sonderlich vorteilhaft zu sein. Gemessen an dem - u.a. biologisch bedingten - relativ niedrigen Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken oder gar daran zu versterben, stellt sich grundsätzlich die Frage nach der Notwendigkeit einer Impfung für Frauen. Ganz offensichtlich aber erzeugen die zugelassenen Vakzine stärkere Nebenwirkungen bei Frauen als bei Männern. Insofern sollte über ein Impfmoratorium für Frauen - und vor allem Mädchen - nachgedacht werden, bis gesicherte Erkenntnisse vorliegen, wie verträglich die Vakzine tatsächlich sind. In Familie und Bildungseinrichtungen sollten die Jungen genauso zu Hygienemaßnahmen angehalten werden wie die Mädchen, Jungen sollte Schwäche erlaubt werden. Auch Indianer weinen manchmal. Und Mädchen Stärke - aber das ist ein anderes Thema. Das BZgA resümiert:
Zur Förderung der Männergesundheit und zur Steigerung der männlichen Lebenserwartung ist ein gesundheitsförderlicher Lebensstil mit körperlicher Bewegung, ausgewogener Ernährung und positiver Stressbewältigung wichtig.
Nur: Wie macht Mann das? - "Zwischen Männern und Frauen bestehen Unterschiede im Informations- und Kommunikationsverhalten. Gesundheitskommunikation im Sinne von Aufbereitung und Vermittlung von gesundheitsrelevanten Informationen und Themen muss daher bei Männern anders gestaltet werden als bei Frauen, wenn gesundheitsförderliche Verhaltensweisen initiiert, beeinflusst oder unterstützt werden sollen",stellt das RKI in seinem Männergesundheitsbericht fest und rät zu einer "gendersensiblen Ansprache":
Für eine gendersensible Ansprache sind darüber hinaus insbesondere geschlechtsspezifische Settings von Bedeutung, bei Jungen und Männern zum Beispiel der Arbeitsplatz, der Sportverein, aber auch die Schule oder Jugendtreffs. Auch hier geht es darum, die Auseinandersetzung mit Gesundheitsthemen in vertrauter Umgebung zu fördern. Gesundheit muss dabei nicht zwingend im Mittelpunkt der Ansprache stehen, sondern in die Lebenswelt der Zielgruppe eingepasst sein.
So können Jungen in einem Jugendclub mit der Zubereitung von gesundem Essen vertraut gemacht werden, weil sie Hunger haben und mit anderen zusammen sein wollen und nicht weil sie etwas über gesunde Ernährung lernen wollen. In ähnlicher Weise können Männer von Workshops erreicht werden, wenn diese nicht ausdrücklich auf das Thema Gesundheit ausgerichtet sind. Auch besteht über die Thematik Arbeit die Möglichkeit, sich den damit zusammenhängenden Belastungen zu nähern und das Thema Gesundheit mit einzubinden.
Männern muss also Gesundheit schmackhaft gemacht und Vorsorge häppchenweise serviert werden. Statt auf den Service einer Partnerin zu vertrauen, wird es Zeit, anerzogene Klischees zu überdenken und auf die Signale des eigenen Körpers zu achten.