Frankreich: Was macht überhaupt… die Linke?
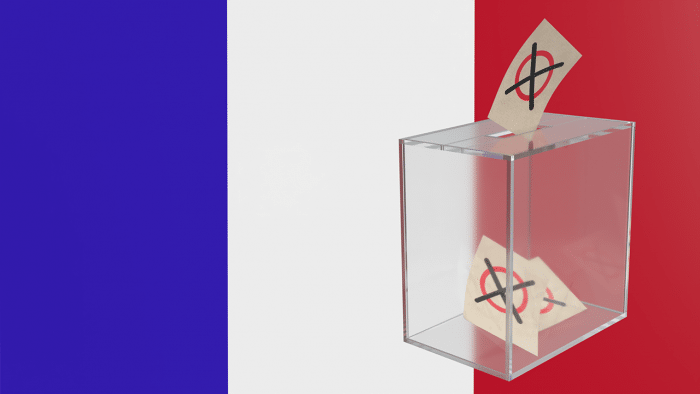
Vor den Präsidentschaftswahlen: Wie es um die Konkurrenz links von Macron steht
Die französische Präsidentschaftswahl beginnt in knapp zwei Monaten. Die beiden Durchgänge der wichtigsten Wahl im politischen System des Landes, das in diesem Halbjahr die EU-Ratspräsidentschaft innehat, finden am 10. April und am 24. April 2022 statt.
Dabei hat der bisherige Favorit der Wahl, der Amtsinhaber im Elysée-Palast und aktuelle europäische Ratspräsident Emmanuel Macron, seine Kandidatur bislang noch gar nicht offiziell angekündigt – auch wenn seine Mitbewerberinnen und -bewerber sich zum Teil bitterlich darüber beschweren, wie Marine Le Pen, die eine, ihr zufolge, Nichteinhaltung der Spielregeln beklagt.
Allerdings erklärten frühere Präsidenten, wie François Mitterrand im Jahr 1988, ihre Kandidatur für eine Wiederwahl oft zu einem ziemlich späten Zeitpunkt. Emmanuel Macron, der sich bei seinen Reisen am Montag und Dienstag vergangener Woche nach Russland und in die Ukraine ostentativ in internationalem Krisenmanagement übte, setzt unterdessen auf die Überzeugungskraft der Aussage, er sei "bei der Arbeit", und demonstrative Betriebsamkeit im Amt.
Bislang steht Macron in den Umfragen, mit einem prognostizierten Stimmenanteil von rund 25 Prozent, stetig vorne. Allerdings ist die Wahl noch nicht gelaufen, und er täte Unrecht darin, würde er das Ergebnis bereits als gegeben voraussetzen.
Kürzlich wurde eine Umfrage veröffentlicht, der zufolge Macron in den Befragungen zum Wahlabschluss – in denen Französinnen und Franzosen nicht danach befragt werden, wen sie wählen würden oder sich selbst als Gewinner wünschen, sondern danach, wem sie unabhängig vom eigenen Standpunkt einen Wahlsieg zutrauen – mit nur noch 21 Prozent abschneidet; einen Monat zuvor waren es noch 27 Prozent.
An zweiter Stelle steht demnach Marine Le Pen mit 14 Prozent Siegesprognosen (unverändert), und ihr ebenfalls rechtsextremer Konkurrent Eric Zemmour landet auf dem dritten Platz mit 11 Prozent (einen Monat zuvor: 7 Prozent). Achtzehn Prozent erklären sich demnach "unentschieden".
Als wichtigste politische Blöcke bei der Präsidentschaftswahl schälen sich demnach in den Augen der Mehrzahl der Befragten das Lager der Unterstützer/innen des wirtschaftsliberalen französischen Staatspräsidenten einerseits und die (in diesem Jahr in zwei Hälften gespaltene) extreme Rechte andererseits heraus.
Doch was ist unterdessen mit der politischen Linken in Frankreich los? Werfen wir einen Blick in ihre Richtung.
Zur historischen Schwäche der Sozialdemokratie
Die gute Nachricht für die Partei zuerst: Erstmals seit dem Präsidentschaftswahlkampf 1969 zeichnet sich ab, dass das Stimmergebnis für die Französische Kommunistische Partei – dem PCF – bei der Wahl im April dieses Jahres an das der französischen Sozialdemokratie heranreichen oder es gar übertreffen könnte. Dies mutmaßt jedenfalls der liberale Print- und Fernsehjournalist sowie politische Kommentator Laurent Neumann.
Nun die schlechte Nachricht: Damals, vor fünfzig Jahren, überflügelte die französische KP regelmäßig die Zwanzig-Prozent-Marke. Im Wahlkampf 1969 schien ihr Kandidat Jacques Duclos zunächst mit dem Bewerber der SFIO, der damaligen Vorläuferpartei des jetzigen Parti Socialiste (PS), Gaston Defferre, gleichauf zu liegen.
Doch im Laufe der Monate brach der Marseiller Oberbürgermeister Defferre ein und erhielt am Ende nur fünf Prozent der Stimmen, Duclos hingegen gut 21 Prozent. Nichts daran ist mit der heutigen Situation zu vergleichen – mit Ausnahme einer katastrophalen Lage des PS, einer Partei, die in ihrer heutigen Form just in Reaktion auf die Wahlkatastrophe unter Defferre 1971 gegründet wurde.
Es ist also lediglich die Schwäche der früheren Regierungspartei unter François Mitterrand und François Hollande, die ihren Rivalen bei der französischen KP heute Chancen auf ein Gleichziehen verleiht. Derzeit sagen die Umfragen dem KP-Kandidaten, dem früheren Journalisten Fabien Roussel, zwei bis höchstens vier Prozent Wähleranteil voraus.
Auch bürgerliche Medien wie der wirtschaftsliberale Sender BFM TV berichten eher ausgesprochen wohlwollend über ihn. Neben einer Erhöhung von Löhnen und Pensionen fordert er auch einen Ausbau der Atomenergienutzung bis 2050, als angeblich klimafreundliche Option, neben dem erneuerbarer Energien.
Doch die Präsidentschaftskandidatin des PS, die Pariser Oberbürgermeisterin Anne Hidalgo, kann sich laut Umfragen ebenfalls nur rund drei Prozent versprechen, zuletzt blieben gar nur noch rund zwei Prozent der Stimmen übrig. Am gestrigen Freitag zeigte ihr eine Umfrage anderthalb Prozent an.
Ihre Kandidatur spricht vor allem urbane, besserverdienende und – durch ihre Politik der spürbaren Reduktion des Automobilverkehrs in der Hauptstadt begünstigt – ökologisch sensibilisierte Mittelklassen sowie höher gebildete Schichten an. Hingegen lässt sie die Lohnabhängigen weitgehend kalt; mittlerweile auch Staatsbedienstete wie Lehrkräfte und Krankenhausbedienstete, die zuletzt noch zu den Kernschichten der sozialdemokratischen Wählerschaft zählten.
Die abhängig Beschäftigten in der Privatwirtschaft, wo der gewerkschaftlichen Organisationsgrad – von Großunternehmen abgesehen – im Vergleich zum Staatsdienst gering ausfällt, kehrten ihr schon zuvor mehrheitlich den Rücken, gingen überhaupt nicht mehr wählten oder stimmten, leider, oftmals rechtsextrem.
Volksnähe übers gute Essen
Fabien Roussel seinerseits versucht sich tunlichst "volksnah" zu geben und zog bis dato vor allem dadurch die Aufmerksamkeit auf sich, dass er das Steak von französischen Rindern, französischen Käse und französischen Wein mit einigem Öffentlichkeitsrummel verteidigte.
Das schockierte grün wählende Veganer/innen und einen Teil der Ökopartei (vgl. Beefsteak und Pommes sind jetzt "politisch rechts"), war allerdings vor allem als Statement für die Kaufkraft von Lohnabhängigen, die sich gastronomische Genüsse erst leisten können müssen, konzipiert.
Dem lebensfreundlichen Zug daran kann man durchaus sympathische Züge abgewinnen – wohinter die allzu berechtigte Kritik an der bestehenden Massentierhaltung nicht zurückstehen darf. Roussel plädierte allerdings auch für die Qualität landwirtschaftlicher Erzeugnisse, was gegen Zuchtbatterien spricht –, allerdings fällt es oft schwer, noch Spurenelemente an Marxismus in den Äußerungen des nominal kommunistischen Kandidaten auszumachen.
Die Bezeichnung der dazugehörigen Partei benutzt er auf seinen Wahlplakaten eher nicht, diese tragen lediglich seinen Namen. In der Vergangenheit wies der PCF eine poststalinistische Bilanz auf, an der durchaus einiges kritikwürdig erschien (von den 1930er-Jahren bis zum Zusammenbruch der UdSSR 1991 verteidigte die Parteiführung im Kern die sowjetische Ordnung), bevor sie ab circa 1994 zur linkssozialdemokratischen Reformpartei wurde, deren separate Existenz neben der französischen Sozialdemokratie sich vielen Betrachter/inne/n allerdings nicht mehr so richtig erschloss.
Historische Schwächesituation
Die in Parteiform auf- oder zu Wahlen antretende politische Linke, sei es die etablierte, die unkonventionell wirkende oder auch die radikale, steht derzeit in einer als zu historisch zu bezeichnenden Schwächesituation. Ihre voraussichtlich sieben Kandidaturen vereinigen nur zwischen 20 und maximal 25 Prozent der Stimmabsichten auf sich.
In der Öffentlichkeit wird die Linke deswegen oft als zerstritten wahrgenommen und diese "Zerrissenheit" wiederum als Grund für ihre derzeitige Einflusslosigkeit dargestellt. In Wirklichkeit dürfte jedoch eher das Gegenteil zutreffen, und der Fernsehjournalist Neumann hat insofern recht, wenn er kurz und knapp postuliert:
Die Linke ist nicht schwach, weil sie gespalten; sondern sie ist gespalten, weil sie schwach ist.
Die Hollande-Jahre: "Pferdeäpfeltheorie"
Es trifft zu, dass die Linksparteien – global betrachtet – seit Beginn der Amtszeit des derzeitigen Staatspräsidenten Emmanuel Macron im Mai 2017 aus einem dauerhaften Tief nicht herauskamen. Ein Hauptgrund dafür liegt in der jämmerlichen Bilanz der Amtszeit François Hollandes, des zweiten, als "sozialistisch" betitelten Staatsoberhaupts in der Geschichte der 1958 begründeten Fünften Republik.
In seinen Amtsjahren von 2012 bis 2017 schlug er, nachdem er im Wahlkampf vor zehn Jahren einige kritisch klingende Sprüche über das Finanzkapital ("la finance, mon ennemi") geklopft hatte, quasi von Anfang an den Kurs einer von ihm selbst als "politique de l’offre" oder "Angebotspolitik" bezeichneten Wirtschafts- und Sozialpolitik ein.
Dies bedeutete, dass die Unternehmen durch massive Steuergeschenke und Senkungen so genannter Lohnnebenkosten gestärkt werden sollten, denn gehe es den Kapitalgesellschaften gut, so werde folglich schon irgendwann etwas für die Lohnabhängigen vom Tisch abfallen.
Der Wirtschaftsliberale Macron – er war unter Hollande zwei Jahre lang Wirtschaftsminister – vertritt bis jetzt nichts Anderes, benutzt dafür nur den klassisch neoliberalen Begriff des trickle down oder französisch ruissellement, also die These angeblichen automatischen Heruntersickerns von Reichtümern von oben nach unten, im Deutschen auch als "Pferdeäpfeltheorie" bezeichnet. In ihrem Namen wird die Maxime "Bereichert Euch!" praktiziert.
An dieser Stelle hatte übrigens der oben erwähnte KP-Kandidat Roussel einen der bisher besten Einfälle im diesjährigen Vorwahlkampf: Bei seiner Großveranstaltung am 06. Februar in Marseille rief er aus, er werde dieses "ruissellement" durch ein "roussellement" ersetzen, ein Wortspiel mit seinem eigenen Namen. Roussellement bedeutet demnach "die Anhebung der Löhne und der Renten". Dem PCF-Kandidaten trug dies einen beträchtlichen Aufmerksamkeitserfolg ein.
Noch in den Achtzigerjahren wurde bekanntlich gelehrt, "Angebotspolitik" sei eine Strategie der politischen (konservativen und liberalen) Rechten, während das sozialdemokratische Gegenstück dazu im Keynesianismus und einer Politik der Ankurbelung der Wirtschaft durch Steigerung der Löhne und der Nachfragefähigkeit und damit des Konsums liege.
Auch wenn diese Gegenüberstellung bereits damals auf einer groben Vereinfachung beruhte, zumal es auch einen rechten Keynesiamismus gibt, der die Konjunktur etwa durch Rüstungsausgaben oder durch staatliche Subventionen zum Flugzeugbau und Beihilfen für die Automobilproduktion ankurbelt (wie weiland die CSU in Bayern oder der historische Gaullismus in den 1960er-Jahren in Frankreich).
Das gigantische Steuersenkungspaket für Unternehmen CICE ab Ende 2012 sah – anders, als zeitweilig lautstark vom linken oder halblinken Parteiflügel des PS gefordert wurde – keinerlei einforderungsfähige Gegenleistungen des Kapitals, wie etwa Investitionen in ökologische Modernisierung oder Berufsbildung, vor.
Es wurde dem Kapital schlicht auf Gutglauben hin gewährt. Folglich opponierten die als "Frondeure" (frondeurs) bezeichneten innerparteilichen Kritiker/innen von Hollandes Kurs im Parlament gegen seine Regierung und drohten auf dem Höhepunkt 2014/15 damit, diese über Misstrauenserklärungen zu Fall zu bringen, schreckten dann jedoch vor diesem Schritt zurück.
Regressive Reform des Arbeitsrechts
Im Hochsommer 2016 wurde dann nach langen Auseinandersetzungen mit Gewerkschaften und Demonstranten die heftig umstrittene, besonders regressive Arbeitsrechtsreform unter dem Namen Loi travail verabschiedet.
Von den damaligen frondeurs blieben politische Spuren übrig, denn der Ehemann der jetzigen sozialdemokratischen Präsidentschaftskandidatin Anne Hidalgo sowie der wohl wichtigste Beraterin ihrer linksliberalen Mitbewerberin Christiane Taubira (der frühere Abgeordnete Christian Paul) entstammen ihren Reihen.
Ihre Inkonsequenz und ihr mangelnder Mut zum wirklichen Bruch mit dem Regierungskurs unter François Hollande sorgten allerdings dafür, dass sie sich keiner Erfolgsbilanz rühmen dürfen und statt ihrer eher der Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon (vgl. unten) zum wichtigsten Herausforderer Hollandes zu seiner Linken werden konnte.
Ein weiterer Grund für die Schwäche der Linken im weitesten Sinne, neben der in vieler Augen ausgesprochen negativen Erinnerung an die Präsidentschaft Hollandes, liegt darin, dass der sozialliberale Flügel der damaligen Regierungsmehrheit längst durch die jetzige aufgesogen wurde.
Rekrutierte Emmanuel Macrons Retortenpartei LREM (La République en marche) doch anfänglich viele frühere Sozialdemokraten, unter ihnen zwei der bisherigen Innenminister unter Macron, Gérard Collomb und Christophe Castaner – ihr jetziger Nachfolger Gérald Darmanin kommt hingegen aus dem Umfeld des Konservativen Nicolas Sarkozy.
Schon bei der Wahl 2017 erzielte das im weitesten Sinne linke Lager nur rund 27 Prozent, auch wenn dieser Tiefstand derzeit noch unterboten wird. Denn die Absorption eines sozialdemokratischen und linksliberalen Segments in das Macron-Lager war damals bereits fortgeschritten.
Linkspopulist Mélenchon
Am ehesten verschont vom Abwärtstrend blieb dabei bislang die zwischen einer linkssozialdemokratischen und einer linksnationalistischen Positionierung oszillierende, ihnen noch ökologische Themen hinzufügende Wahlplattform La France insoumise (LFI, Das unbeugsame Frankreich) unter Jean-Luc Mélenchon.
Dessen persönliches Gebaren, einige arrogante Sprüche und Ausfälle in der Vergangenheit wie sein berühmt-berüchtiger Auftritt "Die Republik bin ich" im Jahr 2018 schadeten ihm nachhaltig; derzeit wird ihm in Umfragen mit knapp zehn Prozent rund die Hälfte seines zwanzigprozentigen Stimmenanteils von 2012 prognostiziert.
Er könnte allerdings bis zum Tag der Stimmangabe noch zulegen, da die demoskopischen Institute oft nur Personen mit als gesichert geltender Wahlentscheidung in ihre Studien einbeziehen, jedoch Angehörige der Arbeitnehmerschaft und der sozialen Unterklassen sich überdurchschnittlich oft erst kurz vor den Wahlen festlegen.
Die Anhänger/innen Mélenchons – er spaltete sich im Winter 2008/09 mit seiner damaligen "Linkspartei", dem PG, vom Parti Socialiste ab – profitieren objektiv davon, dass sie seit damals nicht mehr am Regierungsgeschäft beteiligt war.
Im Unterschied zum PS, aber auch den französischen Grünen, die von 2012 bis 14 unter Hollande mitregierten. Während die letztgenannten beiden Parteien durch die Erinnerung an ihre Regierungsbilanz in einen Abwärtsstrudel gezogen werden, bleibt LFI davon verschont.
Technisch innovative Methoden: Geruchsübermittlung
Ihr Kandidat setzt dabei – wie auch bereits bei seinen letzten beiden Kandidaturen 2012 und 2017 – auf technisch innovative Methoden. Am 16. Januar d.J. in Nantes etwa organisierten seine Unterstützer/innen eine Wahlkampfveranstaltung mit dreidimensionaler Präsentation und "Geruchsübermittlung": Mélenchon präsentierte in der westfranzösischen Stadt in Atlantik-Nähe sein Programm zu einem seiner langjährigen Hauptthemen, zur Ökologie und zur Nutzung der Meere mitsamt ihrer submarinen Rohstoffe.
Dabei sollte das Publikum auch mit Gerüchen, die bspw. an das Meer erinnern sollten, konfrontiert werden. Vielleicht auch aufgrund des Tragens von Corona-Masken ging dies jedoch schief, wirklich viel zu schnuppern gab es jedenfalls nicht.
In den letzten Jahren setzte Mélenchon auf wechselnde Strategien. Mal versuchte er sich an die Spitze einer Sammlungsbewegung der Linkskräfte zu setzen, mal verwarf er – im Gegenteil – die Einteilung in Links und Rechts, um auf eine Vereinigung aller Unzufriedenen gegen das Establishment zu setzen. Zeitweilig ergänzte er dies auch um den Versuch, als besonders EU-kritische Kraft Profil zu gewinnen.
Die Grenzziehung zwischen Links und Rechts
Eingegrenzt wurden diese Tendenzen dadurch, dass sie die strategische Frage aufwarfen, ob man, verwarf man die Grenzziehung zwischen Links und Rechts als zentrale Kategorie, sich nicht auch mit nationalistischen Rechten gegen die Etablierten verbünden könnte. Mélenchon entschied sich letztlich dafür, diesen Weg nicht zu gehen und eine antifaschistische und antirassistische Komponente beizubehalten, zeitweilig auch zu betonen.
Jene, die innerparteilich einen gegenteiligen Kurs steuerten, wurden 2017/18 zum Teil hinausgedrängt wie George Kuzmanovic und Andrea Kotarac. Kuzmanovic strebt derzeit danach, selbst zur Präsidentschaftswahl anzutreten, dürfte jedoch Mühe haben, die für eine Kandidatur erforderlichen 500 Unterstützungsunterschriften von Mandatsträgern aufzutreiben; er tritt auch als Autor des durch die extreme Rechte beeinflussten Vierteljahresmagazins von Michel Onfray, Front populaire, in Erscheinung.
Andrea Kotarac aber trat 2019 dem rechtsextremen Rassemblement National bei, war einer von dessen Spitzenkandidaten bei der Europaparlamentswahl jenes Jahres und versucht dort auch weiterhin, dem Slogan "Wir sind weder links noch rechts, sondern national" vordergründige Glaubwürdigkeit zu verschaffen.
Mélenchon bleibt derzeit argumentativ auf halbem Wege zwischen einer Vereinigung der Linken – unter seiner Hegemonie – einerseits, einer Sammlung "des Volkes gegen das Establishment" andererseits. Was die seit einigen Wochen währenden Debatten zwischen anderen etablierten Linksparteien um Versuche zu einer gemeinsamen Kandidatur betrifft, erklärt er sinngemäß, diese beträfen ihn nicht, er lasse sich nicht in einen solchen Sumpf politischer Kalküle hineinziehen.
Am Herumtaktieren zeigte sich diesbezüglich in den letzten Wochen vor allem Anne Hidalgo. Die Kandidatin des PS wurde zunächst durch eine Urabstimmung von Mitgliedern ihrer Partei bestimmt (…während dem amtierenden PS-Chef Olivier Faure zuvor Ambitionen nachgesagt wurde, auf eine Eigenkandidatur der Partei zur Präsidentschaftswahl gänzlich zu verzichten und eine solche der Grünen zu unterstützen). Das war im Oktober 21.
Im Januar dieses Jahres dann richtete Hidalgo überraschend an die französischen Grünen sowie an die frühere Justizministerin unter François Hollande, die Karibikfranzösin Christiane Taubira, das Angebot, sich gemeinsam einer parteiübergreifenden neuen Urwahl zu stellen und nur den Gewinner oder die Gewinnerin ins Rennen gehen zu lassen.
Hintergrund dafür waren die immensen Schwierigkeiten ihres Wahlkampfs, welcher nun wirklich keine Fahrt aufnehmen mochte. Fernsehbildern von leeren Stühlen bei Veranstaltungen und tiefe, tief Umfragewerte wirkten verheerend. Doch die Umweltpartei wie auch Taubira schlugen aus.
Eine "Vorwahl", die keine wahre Wahl war
Unterdessen bemühte sich durch parteiungebundenen Aktivisten organisierte primaire populaire (sinngemäß: Bevölkerungs-Vorwahl), die vom 27. Januar bis 30. Januar abgehalten wurde, ebenfalls darum, eine parteienübergreifende Präsidentschaftskandidatur auf der Linken einzufädeln.
Dazu trugen sich derzeit 470.000 Stimmwillige in Verzeichnisse ein; es sollte zwischen sieben mehr oder weniger zur Linken gehörenden Bewerberinnen und Bewerbern entschieden werden.
Allerdings handelt es sich dabei nicht im Wortsinne um eine Wahl, also einen Prozess, in dessen Verlauf konkret für oder gegen eine bestimmte Person mit einem bestimmten Programm entschieden wird. Vielmehr ging es bei der primaire populaire um eine Art Notengebung, bei dem die Teilnehmenden etwa die Bündnisfähigkeit, die programmatische Innovation oder die Zukunftsfähigkeit durch Positionierung bei ökologischen Fragen bewerten konnten.
Zu jeder gestellten Einzelfrage durften Zensuren vergeben werden. Insgesamt sieben Präsidenschaftskandidaturen auf der Linken oder in der linken Mitte sollten so benotet werden; jene der französischen KP wurde nicht einbezogen, wohl aufgrund mangelnder ökologischer Sensibilität derselben (die Partei zählt bis heute zu den beinharten Verteidigern der Atomenergienutzung, mittlerweile mit einigen verbalen Abstrichen, aber ohne ernste Zweifel in der Sache.)
Eines der akuten und manifesten Probleme – neben der quasi völlig ausbleibenden Programmdebatte, das Ganze wurde eher wie ein "Ranking" zwischen Personen veranstaltet – dabei war, dass die Mehrzahl der sieben solcherart Bewerteten von dem Verfahren gar nichts wissen wollte. Vier der sieben erklärten bereits vorab, sich nicht an das Ergebnis halten zu wollen, jedenfalls in der Hinsicht, dass dieses einen bestgeeigneten Bewerber oder eine ebensolche Bewerberin bezeichnen würde.
Einige Anhänger/innen der primaire populaire traten deswegen gar zeitweilig in den Hungerstreik (sic!), um moralischen Druck dahingehend auszuüben, dass die unwilligen Kandidat/inn/en zur Teilnahme an dem Auswahlverfahren bewegt werden sollen. Acht Tage später setzten sie ihrem Hungern glücklicherweise wieder ein Ende.Unter anderem Mélenchon hatte ihre Vorgehensweise zuvor scharf kritisiert. Es ist auch irgendwo doof, deswegen ein Frühstück zu versäumen.
Am stärksten ließ sich die frühere Justizministerin Christiane Taubira auf den Prozess ein; sie lobte das Verfahren der primaire populaire und erklärte explizit, sich an ihr Resultat gebunden zu fühlen. Ihre Präsidentschaftskandidatur hatte sie am 15. Januar 22 von Lyon aus erklärt, pünktlich für das Stichdatum, das gesetzt worden war, um bei der primaire-Prozedur berücksichtigt zu werden. Taubira erhielt "die beste Note".
Anne Hidalgo wiederum machte zuvor einen Rückzieher, nachdem die französischen Grünen das ihnen von Hidalgo unterbreitete Angebot zu einer Einheitskandidatur ausschlugen und hielt sich ab da nicht mehr an die Abstimmung und ihre Ergebnisse gebunden.
Die Umweltpartei Europe Ecologie-Les Verts (EE-LV) hatte bei einer eigenen Urwahl ihrer Mitglieder und Sympathisanten im September 21 ihren Kandidaten, Yannick Jadot vom Realoflügel, mit knapper Mehrheit gegen die linksfeministische Gegenbewerberin Sandrine Rousseau nominiert. Jadot zeigte keinerlei Ambitionen, sich einer neuerlichen Urabstimmung etwa in Gestalt der primaire populaire zu unterziehen. (Roussereau wiederum näherte sich in jüngerer Zeit an Taubira an.)
Anne Hidalgo hingegen schien in Wirklichkeit vor allem daran gelegen, ihre eigene Partei zum Verzicht auf ihre Kandidatur zu bewegen, aber zugunsten eines exklusiven Bündnisses mit den Grünen. Das Manöver scheiterte jedoch, hauptsächlich daran, dass die französischen Grünen von späteren Rücksichtnahmen auf andere Parteien unabhängig bleiben wollten.
Aufgrund der Prägnanz des Klimathemas, zu dem in den vergangenen drei Jahren Schülerstreiks und Demonstrationen stattfanden, glaubten die Grünen sich im Aufschwung. Schnitten sie doch bei den Europaparlamentswahlen 2019 vor diesem Hintergrund mit 13,5 Prozent der abgegebenen Stimmen relativ gut ab. Derzeit stagnieren sie dennoch im Wahlkampf und in den Vorwahlumfragen, auch aufgrund ihres mangelnden sozialen Profils, und drohen über fünf bis sechs Prozent nicht hinauszukommen.
Im Januar 21 schloss sich etwa der prominente Umwelt- und Tierschützer und Journalist Aymeric Cayron dem Kandidaten Mélenchon an, mit der Begründung, das ökologische Profil Yannick Jadots sei "fade", und es mangele ihm an der nötigen inhaltlichen Radikalität.
Retterinnenfigur Christiane Taubira?
Madame Taubira wird als Person in linken bis liberalen Kreisen weithin respektiert und eher wenig mit den sozial- und wirtschaftspolitischen Hinterlassenschaften der Hollande-Jahre assoziiert.
Dies liegt aber auch daran, dass sie zu sozio-ökonomischen Themen (anders als zur Justizpolitik) eher selten Stellung nimmt, und zum Teil auch schlicht keinen blassen Schimmer von ihnen zu haben scheint, wie ihr jüngster Auftritt bei gegen Wohnungsknappheit kämpfenden Sozialverbänden aufzeigt. Dort legte sie eine frappierende Ahnungslosigkeit zu den angesprochenen Themen an den Tag.
Taubira legte bis jetzt kein ausformuliertes Wahlprogramm vor, weshalb man davon ausgehen muss, dass ihre wahrgenommene Statur – einer in der Öffentlichkeit als integer geltenden politischen Figur – nicht mit inhaltlicher Programmstärke einhergeht.
2013 wurde die damalige Ministerin zum Opfer offen rassistischer verbaler Angriffe in der Öffentlichkeit; auch attackierten homophobe Kreise die Ministerin damals wegen ihrer Rolle bei der Ausarbeitung des Gesetzes von 2013 zur "Ehe für Alle". In diesen Zusammenhängen war es ebenso ehrbar wie absolut politisch notwendig, sie zu verteidigen.
Neben diesen bekannten Tatsachen weist Taubiras scheinbar lückenlos linksliberales Profil allerdings einige Widersprüche auf. So sprach sie zu Beginn ihrer politischen Karriere 1993 als Abgeordnete der damaligen rechtskonservativen Regierung unter Edouard Balladur zu ihrem Beginn das Vertrauen aus.
Zu Jahresende 2021 zeigte die Parlamentarier von Französisch-Guyana sich zunächst reichlich unkritisch zu den in Frankreichs "Überseegebieten" stark verbreiteten Impfgegner-Thesen, bevor sie infolge wachsender Kritik davon Abstand nahm; inzwischen befürwortet sie eine Impfpflicht.
Aussichten
Erweist sich die aktuelle Periode als schwierig für die staatstragende und als "regierungsfähig" geltende Linke, hält sie auch für die außerinstitutionelle und -parlamentarische radikale Linke keine guten Perspektiven bereit.
Die Bewerber der trotzkistisch inspirierten Parteien Lutte Ouvrière (LO, Arbeiterkampf) und NPA (Neue Antikapitalistische Partei), Nathalie Arthaud und Philippe Poutou, sofern sie die formalen Voraussetzungen für eine Kandidatur in Gestalt von 500 Unterstützungsunterschriften von Mandatsträgern erfüllen können, dürfen zusammen derzeit mit maximal zwei Prozent zusammen rechnen.
Im April 2002 wurden für vergleichbare klassenkämpferische Kandidaturen (damals die von Arlette Laguiller und Olivier Besancenot) zusammen zehn Prozent der Stimmen bei der damaligen Präsidentschaftswahl abgegeben.
Das wichtigste Thema in den Augen der potenziellen Wählerinnen und ist derzeit, ausnahmslos allen Umfragen zufolge, die Kaufkraft, die durch knapp die Hälfte der Befragten genannt wird. Ihr folgen die Auswirkungen der Corona-Krise, Umwelt und Klima, die "Innere Sicherheit" und erst danach – von 25 Prozent der Befragten angeführt – "die Immigration", auch wenn mehrere Kandidaten diese ins Zentrum aller Debatten zu rücken versuchen.
In erster Linie der Rechtsextreme Eric Zemmour, während die Chefin des neofaschistischen Rassemblement National (RN), Marine Le Pen, dessen Konkurrenz auszuweichen versucht, indem sie die traditionellen Kernthemen ihrer Partei relativiert und stattdessen, noch stärker als früher, auf einen vermeintlich sozialen Diskurs setzt. Doch dazu vielleicht demnächst mehr…
