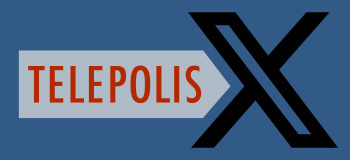Kriegsgeschichten: Was wird uns da erzählt?
Seite 2: Storytelling vs. sachliche Berichterstattung
- Kriegsgeschichten: Was wird uns da erzählt?
- Storytelling vs. sachliche Berichterstattung
- Die blinden Flecken und die Moral von der Geschichte
- Auf einer Seite lesen
Unter dem Titel "Was geschah in Mariupol?" geht es im folgenden ARD-Tagesschau-Beitrag von Korrespondentin Susanne Petersohn aus Kiew kaum in differenzierter und differenzierender Weise um ein komplexes Geschehen im Kontext des Krieges in der Ukraine.
Sondern es wird nicht zuletzt eine Geschichte erzählt. Und zwar diese, sogar im generellen Präsens – einem Merkmal von Storytelling, um das Geschehen als möglichst nah zu vermitteln: "Zu den Zeugen des Angriffes zählt auch der achtjährige Jehor."
Wiederum ein sehr junger Mensch, der höchst sympathisch gezeichnet wird – wir können das sogar buchstäblich an seiner niedlichen Handschrift und an seinen selbstgefertigten Bildern erkennen.
Dieser ARD-Beitrag – der im mittleren Teil auch einige abstraktere Abschnitte mit Bezug auf andere, allerdings ausschließlich pro-ukrainische Quellen enthält – endet, wie er begonnen hat: Mit der tragischen, offenbar wahren Geschichte des Jungen Jehor aus Mariupol, erzählt von der deutschen Journalistin und Jehors Groß-Onkel Jewgeni:
Die Autorin benutzt dabei – Ironie dieses Storytellings, dessen sie sich anscheinend kaum selbstkritisch bewusst ist – sogar immer wieder eigens die Worte "eine Geschichte erzählen":
Diese Bilder (die Fotos des Groß-Onkels Jewgeni, d.A.) erzählen Geschichten von Menschen in einem schrecklichen Alltag in einem brutalen Angriffskrieg. Auch die Geschichte seines kleinen Großneffen Jehor.
Der Tagesschau-Beitrag schließt mit den selbst bemerkenswert narrativen Worten der Journalistin:
Sie (die Fotos) erzählen die Geschichte seiner (des Großonkels, d.A.) geliebten Stadt Mariupol, mit seinen (soll sicher heißen: ihren, d.A.) ukrainischen Bewohnerinnen und Bewohnern. Geschichten vor dem Angriffskrieg. Und Geschichten im Angriffskrieg.
Mal abgesehen vom fragwürdigen Attribut "ukrainische" für die Bewohnerinnen und Bewohner (als ob die Menschen dort sich alle eindeutig und exklusiv so verstanden hätten), das nicht zuletzt auch die klare Tendenz dieser Story verdeutlicht: "Geschichte" in ihrer Widersprüchlichkeit und Komplexität wird nicht nur eingebettet in Einzel-Geschichten, sondern tendenziell (und tendenziös) darin aufgelöst.
Die Instrumentalisierung des Leids
Auch bei diesem Beispiel geht es kritisch-analytisch nicht darum, das Leid der Betroffenen zu leugnen oder zu relativieren.
Im Gegenteil: Deren Leiden wie das aller Leidtragenden solcher Konflikte und Kriege sollte auf vernünftige Weise endlich ernst genommen werden. Und nicht politisch und medial instrumentalisiert werden, zum Beispiel für (weitere) Militarisierung.
Übrigens (und ebenso: leider) gibt es auch auf der jeweils anderen Seite eines Krieges Opfer, nicht zuletzt zivile. Doch finden deren Geschichten in den Leitmedien der als Kriegsparteien verbündeten Staaten kaum Platz.