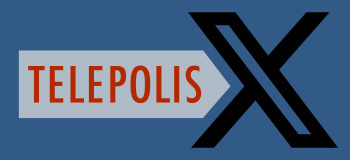Studie sagt dramatischen Lehrermangel voraus
Seite 3: Prognose nach Kassenlage
- Studie sagt dramatischen Lehrermangel voraus
- Bedarf beliebig manipulierbar
- Prognose nach Kassenlage
- Auf einer Seite lesen
Erhellend ist in diesem Zusammenhang eine Aussage, die immer wieder in den Ausführungen der KMK zu ihren Vorausberechnungen auftaucht. Demnach befänden sich die Rahmenbedingungen der Modelle "oft in einem Wandel, der sich durch unterschiedliche, jeweils landeseigene Beschlüsse oder Entwicklungen im Bereich Bildung (wie z. B. Senkung der Klassenhöchststärke, Inanspruchnahme von Altersteilzeiten, vorzeitiges Ausscheiden der Lehrkräfte vor Erreichen der Regelaltersgrenze aus dem Schuldienst, Befristung von Arbeitsverträgen, Entwicklung des Anteils von Teilzeitbeschäftigung, Veränderung des Regelstundenmaßes der Lehrkräfte, Ausbau der Ganztagsschulangebote oder Einführung des achtjährigen Gymnasiums bzw. die Rückumstellung auf das neunjährige Gymnasium) manifestieren kann".
Im Grunde besagt der Satz nichts weniger, als dass die sogenannte Bedarfsprognosen wenig relevant sind, weil jedes Bundesland seine Zahlen unter jeweils spezifischen Umständen, nach politischem Gusto und vor allem nach Haushaltslage ganz exklusiv bestimmt.
Wegen der fehlenden Vergleichbarkeit müsste es sich eigentlich verbieten, sie in einen Topf zu werfen und in einer bundesweiten Statistik abzubilden. Denn wo von Land zu Land verschiedene und beliebig veränderbare Festlegungen über eine "auskömmliche Unterrichtsversorgung" existieren, leiten sich immer auch unterschiedliche Erforderlichkeiten in puncto Personalausstattung ab.
Und wenn etwas einmal nicht passt, wird es passend gemacht, in dem man zum Beispiel eine Flüchtlingskrise verschläft oder einen plötzlichen Kinderboom. Weil Bildung und Schulen über Jahrzehnte immer mehr Ressourcen entzogen wurden, mussten auch die Standards für gute Bildung immer weiter abgesenkt werden.
Das führte unter anderem dazu, dass für immer mehr Schülerinnen und Schüler immer weniger Pädagogen zur Verfügung stehen und der Lehrerberuf nachhaltig entwertet wurde – etwa durch die Umstellung auf die Bachelor-Master-Studienstruktur, eine verschleppte Reform der Lehrerausbildung oder politische Stimmungsmache gegen eine "faule und überbezahlte" Lehrerschaft.
Bildung statt Bomben
"Es ist im mehrfachen Sinne fatal und nicht hinnehmbar, wenn sich die Politik angesichts kaum kalkulierbarer und nicht einberechneter Mehrbedarfe, wie sie aktuell etwa die Auswirkungen der Flüchtlingsbewegungen und Pandemie erfordern, seriöser Berechnungen auf Basis bekannter Parameter verschließt und den immensen Handlungsdruck hierdurch wiederholt kaschiert", monierte sodann auch der VBE-Vorsitzende Beckmann und erklärte weiter: "Die Politik kann sich nicht mehr aus der Verantwortung stehlen und sagen, sie hätte es nicht besser gewusst."
Auch Anja Bensinger-Stolze, bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) für den Vorstandsbereich Schule zuständig, wirft der Politik Untätigkeit vor. "Seit Jahren versuchen sich die Länder und auch die KMK daran vorbeizumogeln, dass hier längst Zeit in Verzug ist", äußerte sie sich am Dienstag gegenüber Telepolis. Mancherorts könnten "nur noch 50 Prozent der freien Stellen mit ausgebildeten Lehrkräften besetzt werden".
Die Versäumnisse blockierten Reformen wie die Inklusion und beschädigten "insgesamt zunehmend Qualitäts- und professionelle Standards", so Bensinger-Stolze. Im Zentrum müssten deshalb die "Behebung des personellen Mangels, die Steigerung der Attraktivität der pädagogischen Berufe in Bildung und Erziehung sowie deren angemessene und faire Bezahlung" stehen.
Der VBE sieht ebenfalls die Bundesregierung in der Pflicht. So brauche es eine "bundesweite Fachkräfteoffensive", um deutlich mehr Schulabgänger für den Lehrerberuf zu gewinnen, mehr Studienplätze sowie eine verbesserte Lehramtsausbildung und die gleiche Bezahlung aller Lehrkräfte "unabhängig von Schulform und -stufe". Auch müsste die Integration von Seiteneinsteigenden oder Pensionisten stetig evaluiert werden. Es müsste auch eine "mindestens sechsmonatige Vorqualifizierung" grundsätzlich sichergestellt sein.
Ein Wörtchen fehlt derweil im Forderungskatalog: Geld. Daran sollte es nicht mangeln, konnte die Bundesregierung doch über Nacht 100 Milliarden Euro bereitstellen, um die Bundeswehr aufzurüsten. Bildung sollte auf der Prioritätenliste eigentlich vor Bomben stehen.
Empfohlener redaktioneller Inhalt
Mit Ihrer Zustimmung wird hier eine externe Buchempfehlung (Amazon Affiliates) geladen.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen (Amazon Affiliates) übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.