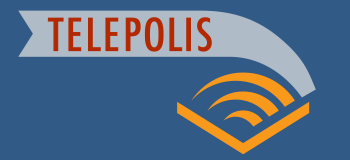Forencheck: der RS-Virus, "Omnibus"-Gesetze und Enteignungen
Seite 3: Check 3: Verhindert Enteignung Neubau?
- Forencheck: der RS-Virus, "Omnibus"-Gesetze und Enteignungen
- Check 2: Gesetzesänderung per Omnibusverfahren - ein unvorstellbarer Vorgang?
- Check 3: Verhindert Enteignung Neubau?
- Auf einer Seite lesen
"Da die Enteignung nicht entschädigungslos wäre, besser davon selber bauen", fordert ein User in Bezug auf den Artikel "'Triell' vor der Bundestagswahl: Baerbock gegen Enteignung" und weiter:
Seien wir uns darüber klar, eine entschädigungslose Enteignung wird es nicht geben. Rechtlich und politisch nicht durchsetzbar.
Da sollte man den Millardenwert, den man als Entschädigung zahlen müsste, doch lieber nehmen und neu bauen. Würde dem Wohnungsmarkt sicherlich mehr helfen als der Kauf existierender Wohnungen.
Wenn die Mieter bezahlbare Alternativen hätten, könnten die Mietpreise auch nicht weiter angehoben werden.
User ollid
Es ist richtig, dass über eine entschädigungslose Enteignung beim Volksentscheid in Berlin nicht abgestimmt wird. Allerdings unterscheiden sich die Einschätzungen der Initiative "Deutsche Wohnen & Co Enteignen" und des Berliner Senats, welche Entschädigungssumme zu entrichten wäre.
Laut Initiative betrüge diese 7,3 bis 13,7 Milliarden Euro, laut Senat 28,8 bis 36 Milliarden Euro plus Erwerbsnebenkosten. Die Initiative argumentiert, dass die Enteignung haushaltsneutral möglich wäre:
Wir schlagen vor, dass die Anstalt öffentlichen Rechts (in die die Wohnungen überführt werden sollen, Anm. d. Autorin) die Entschädigung aus Krediten oder Schuldverschreibungen finanziert, die durch die stetigen Mieteinnahmen abbezahlt werden können. Der Berliner Haushalt wird nicht belastet, sodass keine Konkurrenz zu anderen notwendigen Ausgaben entsteht. Auch wenn noch weitere Konzerne zur Liste der Enteignungskandidaten hinzukommen, gibt es kein Problem mit der Finanzierung: Mehr Wohnungen liefern mehr Mieteinnahmen, die höhere Entschädigungssummen finanzieren können. Sind die Schulden einmal abbezahlt, können die Mieteinnahmen sogar in weiteren Neubau investiert werden.
Argumentiert man, dass mit dem Geld besser neue Wohnungen gebaut werden sollten, um den Mietwohnungsmarkt zu entlasten, muss beachtet werden, in welchem Segment neuer Wohnraum geschaffen wird.
Zwar beruft sich die Immobilienwirtschaft häufig auf einen "Sickereffekt", das heißt, dass durch Umzugsketten günstigere Wohnungen frei würden, in einem angespannten Wohnungsmarkt wie Berlin ist mit einem solchen Effekt aber nicht zu rechnen.
Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) hat anhand der Umzugsbewegungen in den Städten Bremen, Köln, Leipzig und Nürnberg in den Jahren 2016 und 2017 untersucht, wie weit der Sickereffekt reicht. Eine neu gebaute Wohnung hat - je nach Stadt - nur 2,2 bis 3,2 Umzüge ausgelöst. Die Umzugskette reißt also schon früh ab und die Entspannung kommt "unten" nicht an. Gründe dafür sind zum einen die vielen Zuzügler von außerhalb, die - ohne selbst eine Wohnung innerhalb der betreffenden Gemeinde freizumachen - mit ihrer Anmietung die "Sickerkette" unterbrechen. Zum anderen heben Vermieter bei der Wiedervermietung der freigezogenen Wohnungen die Mieten stark an, so dass sie für Mieter mit wenig Geld nicht mehr verfügbar sind.
Jens Sethmann dazu im MieterMagazin
Abhilfe könnte wohl nur der gezielte Bau preisgebundener Wohnungen schaffen. Deren vorgeschriebenen Anteil am Neubau in Höhe von 30 Prozent möchte die derzeit in den Umfragen führende Bürgermeisterkandidatin der SPD allerdings nicht erhöhen.