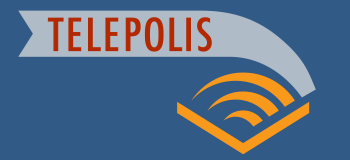Geheimdienste: Wer Putin verstehen darf, ohne als "Putin-Versteher" zu gelten

Auch westliche Diplomaten zeigten sich teilweise überrascht, als Putin im Ukraine-Konflikt so eindeutig die Rolle des Aggressors annahm. Symbolbild: Mabel Amber auf Pixabay (Public Domain)
Niedersachsens Verfassungsschutz soll Parteien und Organisationen ins Visier nehmen, die "womöglich eine besondere Nähe zu Putin" haben. Die CIA versucht unterdessen, seine Denkweise zu ergründen
"Bis zu 2000 Putin-Agenten in Deutschland", warnte die Bild am Wochenende unter Berufung auf Sicherheitsbehörden. Der CSU-Politiker Stephan Mayer, ehemals Parlamentarischen Staatssekretär im Innenministerium, fordert laut einem Bericht des Münchner Merkur eine "sehr engmaschige Kontrolle russischer Geheimdienstmitarbeiter durch den Verfassungsschutz".
Das geht natürlich nur, wenn sie schon als solche enttarnt sind – und das passiert Spionen, die Zugang zu Staatsgeheimnissen haben, weil sie sich zum Schein perfekt anpassen, eher nicht wegen solcher Medienberichte. Die nächsten Wochen und Monate werden zeigen, ob Bild-Leser nicht eher jeden verdächtigen, dessen Nase, Akzent oder Meinung ihnen nicht passt. Schließlich haben wir nach den Worten des Bundeskanzlers eine "Zeitenwende" und die Nerven liegen blank.
Auch die Arbeit der Verfassungsschutzämter in Bund und Ländern dürfte durch den russischen Einmarsch in die Ukraine in nächster Zeit einen stärkeren Russland-Bezug bekommen.
Im vergangenen Jahr hatten deutsche Nachrichtendienste noch vom Rechtsextremismus als größte Gefahr für die Demokratie gesprochen. Gemeint waren deutsche Neonazis – Russlands Präsident Wladimir Putin wurde damals im politischen Diskurs noch nicht ganz so oft mit Hitler verglichen und die ultrarechten türkischen "Grauen Wölfe" fielen beim Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) in die Kategorie "Sicherheitsgefährdende und extremistische Bestrebungen von Ausländern".
Die Russische Föderation wurde im Jahresbericht des BfV für 2020 weiter hinten im "Kapitel Spionage, Cyberangriffe und sonstige sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche Aktivitäten für eine fremde Macht" erwähnt. Die Verfassungsschutzberichte von Bund und Ländern für 2021 liegen noch nicht vor. Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, ließ aber im Juni verlauten, dass russische Dienste in Deutschland so aktiv wie im Kalten Krieg seien.
Rechte Außenseiter, die "Mitte" und der äußere Feind
Dass sich aktuell Kleinparteien deutscher Neonazis nicht einig sind, welche Seite sie im Krieg Russlands gegen die Ukraine unterstützen sollen – die NPD hält trotz ihrer Täter-Opfer-Umkehr in Bezug auf den Zweiten Weltkrieg paradoxerweise zu Russland, der "III. Weg" zur Ukraine – liegt an der Beteiligung ultrarechter Gruppen auf beiden Seiten.
Berichte über die mit angeblich rund 400 Söldnern auf russischer Seite kämpfende "Gruppe Wagner" und das ukrainische Asow-Bataillon müssen jedenfalls für Neonazis, die echte Kampferfahrung sammeln wollen und wegen ihrer Verfassungsschutzakte nicht zur Bundeswehr können, attraktiv klingen.
Aber die wahrscheinlich eher kleine Anzahl deutscher Freiwilliger aus der rechten Szene für den bewaffneten Kampf in der Ukraine dürfte nicht der Hauptgrund sein, wenn sich die Prioritäten der Inlandsgeheimdienste aktuell verschieben. Es geht weniger um ein paar Außenseiter als darum, dass die Mitte der Gesellschaft und alle, die noch irgendwie dazugehören wollen, gegen einen äußeren Feind zusammenstehen sollen.
Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat vergangene Woche klargestellt, "dass der Verfassungsschutz sein Augenmerk derzeit besonders auf diejenigen Organisationen und Parteien im Land richtet, die womöglich eine besondere Nähe zu Putin auszeichnet". Das bedeute auch, "dass Teile der AfD unter diesem Gesichtspunkt noch einmal ein Stück weit mehr in den Fokus rücken". Gleiches gelte "für Teile der Bewegung, die sich gegen die Corona-Maßnahmen wendet, denn hier es gibt eine Schnittmenge", sagte Pistorius der Zeitung Die Welt.
Die AfD darf der Verfassungsschutz laut einem Urteil des Kölner Verwaltungsgerichts vom Dienstag offiziell als "Verdachtsfall" in Sachen Rechtsextremismus einstufen und beobachten.
Eine Nähe zum russischen Präsidenten als "Schnittmenge" sehen manche Medien und die politische Konkurrenz aber nicht nur in der AfD und bei den Corona-"Querdenkern", sondern auch in Teilen der SPD, der Pistorius selbst angehört, sowie in der Partei Die Linke. Wenn in den letzten Jahren von "Russland-Verstehern" oder auch "Putin-Verstehern" die Rede war, fehlte aber meistens die Trennschärfe zwischen "Verstehen" im Sinne von Begreifen, wie das Gegenüber tickt, und billigendem Verständnis.
Letzteres wurde dann auch gern Politikern unterstellt, die es nur begreifen wollten, um eine kriegerische Eskalation zu vermeiden – wobei sie bis zuletzt nicht gedacht hätten, dass dieser Schritt von Putin ausgehen würde.
Keine der im Bundestag vertretenen Parteien rechtfertigt aber den russischen Angriff auf die Ukraine – auch Abgeordnete, die deshalb nicht auf Kritik an der Nato verzichten wollen und im Bundestag gegen den Entschließungsantrag der Regierungsparteien und der Union stimmten, haben diesen Angriffskrieg verurteilt und Fehleinschätzungen über den russischen Präsidenten eingeräumt.
In der Partei Die Linke wurde vergangene Woche darüber gestritten, ob es wirklich nötig war, dass sieben Abgeordnete dann noch eine Erklärung zur Vorgeschichte und zur Nato abgaben, als relativiere sich dadurch die Verurteilung des Angriffskriegs. Die Angst vor dem Vorwurf der Feindbegünstigung und vor Kontaktschuld durch Parteifreunde, die zwar nicht Putins Freunde, aber auch nicht ganz auf Linie des "Wertewestens" sind, war offensichtlich groß.
So stellt sich die Frage, was "womöglich eine besondere Nähe" heißt – und wie viele Einzelpersonen sich wie geäußert haben müssen, um den Verdacht gegen ihre Partei oder Organisation zu begründen.
Was die SPD betrifft, steht nicht nur Altkanzler Gerhard Schröder als Aufsichtsratsratsmitglied des russischen Energiekonzerns Rosneft, Vorsitzender des Gesellschaftsausschusses der Nord Stream AG und langjähriger Freund von Wladimir Putin unter Druck. Manche SPD-Genossen fordern inzwischen Schröders Parteiausschluss.
Allerdings kann kaum jemand wissen, ob er nicht längst von deutschen oder anderen westlichen Nachrichtendiensten gebrieft wurde, um inoffizielle Gesprächskanäle offenzuhalten und im Ernstfall zu deeskalieren. "Vielleicht ist Gerhard Schröder tatsächlich der Letzte, der noch einen Draht zu Putin hat. Dann wäre es fatal, diesen zu kappen", spekulierte am Montag ein taz-Redakteur.
Auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ist SPD-Mitglied und wehrte sich unlängst gegen Versuche, ihre Landesregierung "als 'Putin-Freund' oder 'Putin-Versteher' zu diskreditieren". Bis zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine war sie Befürworterin der Gaspipeline Nord Stream 2, was ihr auch nach einer 180-Grad-Wende längst nicht von allen verziehen wird.
Wer versteht Putin wirklich?
Den vermeintlichen Putin-Verstehern wird jetzt die Rechnung dafür präsentiert, dass sie den russischen Präsidenten in letzter Zeit eben nicht wirklich verstanden und ihm diesen Angriffskrieg nicht zugetraut haben. Dafür sollen sie sich nach Meinung politischer Gegner noch eine Weile schämen und möglichst still sein.
Westliche Analytiker und Geheimdienste – allen voran die CIA – versuchen momentan angeblich fieberhaft, Putins Denkweise zu verstehen, damit er für sie berechenbarer wird. Profiler sind damit beauftragt. So gesehen war das Wort "Putin-Versteher" als Synonym für "Putin-Freund" schon immer irreführend, denn jeder politische Akteur wünscht sich auch und gerade seine Gegner so berechenbar wie möglich. Das gilt sogar unabhängig davon, ob militärische oder diplomatische Lösungsansätze bevorzugt werden.
Manchen westlichen Diplomaten war angeblich auch lange Zeit nicht klar, dass Putin in dem seit acht Jahren schwelenden Ukraine-Konflikt so eindeutig die Rolle des Aggressors übernehmen würde. Nach Medienberichten sprechen "mehrere Personen, die Putin seit längerer Zeit beobachten" von einer Verhaltensänderung und zweifeln an seiner geistigen Gesundheit. Der ehemalige US-Botschafter in Russland, Michael McFaul, nannte den russischen Präsidenten vergangene Woche in einem NBC-Interview "zunehmend verwirrt".
Wer heute noch große Stücke auf Putin hält, kann das zwar als typischen Pathologisierungsversuch in einem Propagandakrieg abtun – andererseits spricht es dagegen, dass alle, die ihm den Angriff nicht schon seit Jahren zugetraut haben, verblendete "Putin-Freunde" waren. Denn offensichtlich hätten das auch manche seiner Gegner nicht von ihm gedacht.
Viele, die Putin zwar nie für einen guten Demokraten, aber immer für einen rationalen Strategen hielten, der sich international nicht isolieren und bei russischen Soldatenmüttern nicht unbeliebt machen will, indem er ihre Söhne verheizt, mussten seit dem Einmarsch in die Ukraine eingestehen, dass sie sich geirrt haben.
Putin könnte durch diesen Krieg im eigenen Land an Rückhalt verlieren und die Partnerschaft mit China auf eine harte Probe stellen, während in den nicht direkt am Krieg beteiligten Nato-Ländern die Zeit der Aufrüstungs-Wunschkonzerte angebrochen ist und in bisher neutralen Ländern Sympathien für die Nato wachsen.
Julian Reichelt gegen "feindliche Millionen"
Andere behaupten dennoch gerade jetzt, Putin handle in seinem Sinn rational – er nutze einfach die fehlende Weltkriegsbereitschaft des Westens aus. Und manche Publizisten finden eine Weltkriegs-Vermeidungshaltung im Atomzeitalter problematisch.
Wenige Tage, nachdem Putin unter anderem die Atomstreitkräfte seines Landes in Alarmbereitschaft versetzt hatte, schrieb der ehemalige Bild-Chefredakteur Julian Reichelt am Sonntag auf Twitter: "Die unbequeme und lange verdrängte Frage, die uns nun mit Wucht trifft: Wird der Dritte Weltkrieg wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher, wenn wir glaubwürdig und absolut entschlossen bereit sind, ihn zu führen?"
Auch in einem Gastbeitrag für das Magazin Cicero stellt Reichelt klar, dass er nicht nur Putin und dessen enges Umfeld als zu bekämpfende Feinde betrachtet, sondern Millionen Menschen:
Natürlich haben wir es mit einer feindlichen Macht, mit feindlichen Millionen, nicht bloß mit einem feindseligen Mann zu tun. Und natürlich residiert dieser Feind mit seinen Propaganda-Sendern, Social-Media-Armeen, Immobilien, Fußballvereinen, Bankkonten mitten unter uns. Putin lag richtig mit der Einschätzung, dass es freien, reichen westlichen Gesellschaften sehr schwer fällt, andere Feinde zu erkennen als den Klimawandel.
Julian Reichelt am 6. März im Cicero
Eine Denkweise, die Reichelt hier als besonders mutige Minderheitenposition darstellt, hat in Wirklichkeit längst dazu geführt, dass Menschen russischer Herkunft – einschließlich Kinder – in Deutschland massiv unter Rechtfertigungsdruck stehen, falls ihnen nicht gleich unabhängig von ihrer Meinung Hass entgegenschlägt. Davon berichtet etwa der Schriftsteller Wladimir Kaminer, der für seine kritische Haltung zu Putin bekannt ist.
Putin-Totenkopf und SS-Runen: Linke von Unbekannten als Feindin markiert
Die außenpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Europaparlament, Özlem Alev Demirel, fand am Dienstag einen Aufkleber mit Putin-Totenkopf und dem Schriftzug "Achtung Russia" mit SS-Runen an ihrer Bürotür. Dabei hatte sie den Angriffskrieg auf die Ukraine klar als solchen benannt und verurteilt, die Parlamentsresolution zum Ukraine-Krieg aber in ihrer Gesamtheit abgelehnt.
Die deutsche Politikerin kurdischer Herkunft hatte kritisiert, dass die EU-Kommission sich nicht für einen Waffenstillstand und Verhandlungen einsetzt, sondern "Durchhalteparolen" an die Ukraine adressiert, während bei den Kampfhandlungen jeden Tag Menschen sterben. Sie hatte kritisiert, dass die EU "nicht alles mobilisiert, was sie hat, aber doch eine ganze Menge: von Sanktionen bis hin zur Lieferung schwerer Waffen im Rahmen der Europäischen Friedensfazilität". Demirel warnt vor dem Missbrauch dieses Leids in der Ukraine für den Umbau der EU zur "Militärunion".
In einem Interview mit dem Jacobin-Magazin erklärte Demirel ihre Haltung so:
Ich denke an die Zeit und den immensen Druck vor dem ersten Weltkrieg, als Karl Liebknecht und die SPD noch den ersten Kriegskrediten zugestimmt haben. Bei der zweiten Abstimmung wagte Liebknecht sich dann und stimmte – zunächst ganz allein – gegen weitere Kriegskredite. Heute wissen wir: Er hatte recht. Politische Handlungen dürfen nicht allein aus dem Reflex des Augenblicks erfolgen, sie müssen das, was auf uns zukommt, immer mit in den Blick nehmen.
Ich war nie eine "Putinversteherin" und habe den russischen Imperialismus auch bei vorherigen Kriegen immer deutlich kritisiert – anders als vielleicht manche andere. Aber ich verschließe auch nicht meine Augen vor dem Imperialismus der Regierungen in meiner Heimat oder der gesamten EU. Ich stehe an der Seite der Völker für Frieden und soziale Sicherheit, gegen Kriege und Eskalationen in dem Kampf um Einflusssphären.
Özlem Alev Demirel
Karl Liebknecht, auf den sich Demirel bezieht, war auch kein Freund des russischen Zaren Nikolaus II., als er sich gegen den Krieg positionierte. Die Mehrheit der sozialdemokratischen Politiker hielt aber diesen Krieg, in dem insgesamt mehr als neun Millionen Soldaten fielen, davon zwei Millionen Deutsche und 1,8 Millionen Russen, für notwendig und gerecht. Daran werden SPD-Mitglieder wie Bundeskanzler Olaf Scholz und der niedersächsische Innenminister heute nicht gern erinnert.
So gesehen könnte der Vorwurf der Feindbegünstigung auch heute wieder zum Totschlagargument gegen Kritik am eigenen Kurs werden.
Empfohlener redaktioneller Inhalt
Mit Ihrer Zustimmung wird hier eine externe Buchempfehlung (Amazon Affiliates) geladen.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen (Amazon Affiliates) übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.