Globale Aufrüstung: Abschreckung ist keine Lebensversicherung
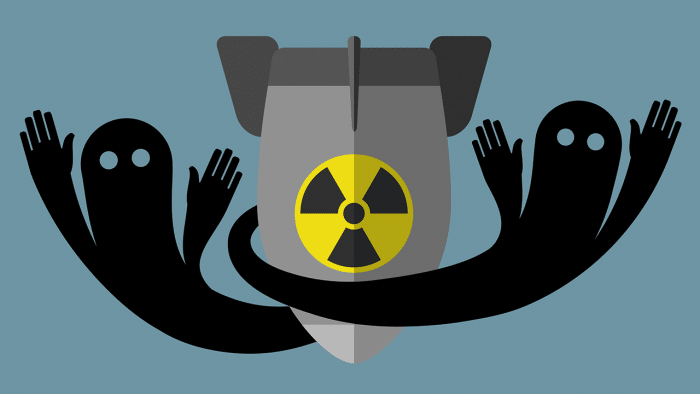
- Globale Aufrüstung: Abschreckung ist keine Lebensversicherung
- Fußnoten
- Fußnoten
- Fußnoten
- Fußnoten
- Auf einer Seite lesen
Obwohl Abschreckung als Lebensversicherung propagiert wird, zweifeln Experten. Die Risiken eines atomaren Konflikts bleiben hoch. Droht uns eine neue Eskalation?
"Die nukleare Abschreckung der Nato ist unsere ultimative Sicherheitsgarantie", so Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Doch nukleare Abschreckung ist, wie Experten betonen, ein Spiel mit dem Feuer.
Ins gleich Horn hatte kürzlich auch Verteidigungsminister Pistorius gestoßen. "Effektive Abschreckung ist unsere Lebensversicherung", so meinte er. Wie das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri meldet, werden immer mehr atomare Sprengköpfe einsatzbereit gemacht.
Ein zweiter kalter Krieg beginnt
Klar ist also: Es geht wieder los. Was wir einmal nur mit knapper Not überlebt haben, das muss nun ein weiteres Mal durchgestanden werden. Jedenfalls nach den Vorstellungen jenes Milieus, dass die Leitmedien und die Politik beherrscht. Der zweite Kalte Krieg ist fällig. Wir Bürgerinnen und Bürger sind nicht gefragt worden. Wie seit alters her üblich, liefern wir im Zweifelsfall die Leichen.
Doch ist Abschreckung wirklich eine "Lebensversicherung", wie Pistorius behauptet? Die Fachwissenschaft urteilt vorwiegend ganz anders als dieser Minister oder auch Stoltenberg. Nach Auffassung vieler Experten jedenfalls ist die atomare Abschreckung höchst wackelig und unsicher.
So etwa der Atomwaffenexperte der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik, Peter Rudolf, einer der wenigen ausgesprochenen Spezialisten der atomaren Abschreckung in Deutschland:
Bei der nuklearen Abschreckung handelt es sich um ein Konstrukt, ein System von nicht verifizierbaren Annahmen, das geradezu ideologischen Charakter hat. Abschreckungspolitik beruht auf Axiomen, für die es keine empirische Evidenz im wissenschaftlichen Sinne gibt, sondern allenfalls anekdotische Evidenz, deren Interpretation also glaubensgeleitet ist. Der Glaube an die nukleare Abschreckung ist ebendies – ein Glaube.
Viele meinen, die Wirksamkeit der Abschreckung habe sich im Kalten Krieg bewiesen. "Befürworter der nuklearen Abschreckung" so Rudolf1, "behaupten immer wieder, diese habe über Jahrzehnte den Frieden zwischen Ost und West gesichert. Deshalb sei sie auch in Zukunft ein Garant für die Abwesenheit von Krieg zwischen atomar bewaffneten Staaten und Bündnissen. Doch die Rede vom nuklearen Frieden ist nicht mehr als eine spekulative Hypothese … Mit Gewissheit kann gesagt werden: Ein bewaffneter Konflikt zwischen Atommächten ist keineswegs ausgeschlossen."
Solche Urteile von Menschen, die dieses Thema wissenschaftlich bearbeiten, sind Legion. Ich beschränke mich hier auf eine einzige weitere Aussage. Ralph Rotte, Politikwissenschaftler an der Technischen Hochschule Aachen, ein Spezialist für die Fragen von Krieg und Frieden, urteilt so2: "
Insgesamt kann man davon ausgehen, dass die empirische Haltbarkeit der Abschreckungstheorie durchaus fraglich ist.
Es steht viel auf dem Spiel
Verlangt nicht die politische Vernunft, dass solche Urteile ernst genommen werden? Wenn so viel auf dem Spiel steht, weshalb dann nicht der Vorsicht den Vorrang geben vor der blinden Übernahme von Allerweltsmeinungen. Und es steht wahrlich viel auf dem Spiel.
Nach Auswertung einer Vielzahl von Studien zu den Auswirkungen von Atomkriegen, kam die Organisation Internationale Ärzt:innen für die Verhütung des Atomkriegs zu einem erschütternden Ergebnis: Auch wenn nur ein winziger Teil des heutigen Atomwaffenbestandes zum Einsatz kämme, würde dies neben der endgültigen Zerstörung des Klimas rund zwei Milliarden Menschen den Hungertod bescheren.3
Es wäre also nicht so, wie viele beiläufig in einem Gespräch zum Thema mitteilen: "Im Falle eines Atomkriegs wären wir ohnehin alle sofort weg." Angst sei also überflüssig. Selbst ein sehr begrenzter Krieg mit nuklearen Waffen würde vor allem zu einem langsamen und äußerst qualvollen Sterben der Menschen rund um den Globus führen.
Die Zivilisation, wie wir sie kennen, würde nicht mehr existieren. Wer im Unterschied zu vielen anderen fähig ist, so etwas an sich herankommen zu lassen und sich in die vielen weiteren Folgen hineinzudenken, wird von leichtsinnigen Behauptungen Abschied nehmen. Keinesfalls erhöht die Abschreckung unsere Sicherheit!
Die Widersprüche in der Abschreckungstheorie
Gehen wir ganz knapp die Voraussetzungen durch, auf denen die Abschreckungstheorie basiert und ihre Widersprüche. Etwa der Voraussetzung, dass alle Akteure rational handeln, also kein Entscheider sich von Affekten leiten lässt. Rein intuitiv ist das wohl eine eher verwegene Annahme.
Wir müssen nicht an Hitler, Trump oder Kim Jong-un in Nordkorea denken, um zu wissen, dass Politiker keineswegs immer Ausbünde an sachlicher Rationalität sind. Rational handeln im Zusammenhang der Abschreckung heißt, in der Lage zu sein, eine Kosten-Nutzen-Analyse anzustellen. Welchen Nutzen würde es bringen, eine Nuklearwaffe einzusetzen, wenn man an die möglichen Kosten denkt, also an den Schaden, den einem der Gegner beibringen kann.
Seit die "Prospect-Theorie" entwickelt wurde, die ihren Entwicklern den Nobelpreis einbrachte, wissen wir nun auch wissenschaftlich verbindlich, was wir eigentlich alle ahnten: Menschen handeln keineswegs immer rational, sondern gerade bei wichtigen Entscheidungen nicht selten höchst irrational.
Die Psychologen Daniel Kahneman und Amos Twersky konnten auf empirischer Basis zeigen, dass Entscheidungen besonders dann eher irrational ausfallen, wenn es darum geht, große Verluste zu vermeiden. Dann werden die Kosten kleingeredet oder ausgeblendet.
Eine typische derartige Situation könnte eintreten, wenn Putin, sagen wir, durch Truppen aus Nato-Ländern in die Enge getrieben wird. Seine Kosten-Nutzen-Kalkulation könnte dann reichlich irrational ausfallen. Bevor jedenfalls Putin, wie Selenskyj fordert, die Krim zurückgibt und Reparationen anbietet, dürfte er eher zum Äußersten schreiten.
Das Glaubwürdigkeitsproblem
Neben der Voraussetzung, dass sich alle Akteure rational verhalten, ruht die Abschreckungstheorie darauf, dass Abschreckungsdrohungen vom Gegner auch wirklich ernst genommen werden. Das heißt: Abschreckung muss glaubwürdig sein. Putins Glaubwürdigkeit in dieser Angelegenheit leidet zurzeit sehr, weil er ständig mit Atomwaffen droht, aber nichts passiert.
Naheliegend ist es, anzunehmen, dass er darüber nachdenkt, nun endlich Fakten zu liefern, also die atomare Schwelle zu übertreten. Und sei es mit einem "Demonstrationsschlag" sagen wir über dem Schwarzen Meer in enormer Höhe, womit noch kaum ein ins Gewicht fallender Schaden angerichtet würde. Wir können nur hoffen, dass ihm beim Grübeln darüber nicht der Geduldsfaden reißt.
Doch auch die USA haben ein Glaubwürdigkeitsproblem, insbesondere, wenn Putin ernstmachen würde. Würden sie auf einen solchen Demonstrationsschlag nicht "angemessen" reagieren, wäre ihre Glaubwürdigkeit in der Abschreckung ramponiert.
Aus der Sicht der USA käme es unbedingt darauf an, dass jeder weiß und jeder sieht: Die USA lassen nicht mit sich spaßen!
Man würde also die in den vergangenen Jahren bis ins Detail spezifizierten nuklearen Arsenale durchforsten und sich dann entscheiden, welch Reaktion als "angemessen" einzustufen sei.
Vielleicht statt einer jetzt zwei Nuklearexplosionen, vielleicht hoch über der Ostsee? Ebenfalls als Gegendemonstration, dass man das Duell und seine Konsequenzen nicht scheut? Auf jeden Fall müsste die Reaktion etwas stärker ausfallen als das Vorgehen Russlands.
Das wäre dann – in Erwartung der russischen Gegenreaktion – der Einstieg in die nukleare Eskalation, falls der Gegner nicht klein beigibt.
Der Zwang zur Glaubwürdigkeit in der Abschreckung führt also in ein Dilemma. Gemeint ist, dass Glaubwürdigkeit grundsätzlich darauf zielt, durch Abschreckung den Status quo zu bewahren oder zu deeskalieren.
Putin definiert den Status quo allerdings anders als die Ukraine und der Westen. Doch generell gilt, dass hinter der Abschreckung auch ein starker Impuls steht, gewissermaßen proaktiv das hochdifferenzierte Arsenal von Atomwaffen auch real zu nutzen. Aus der Sicht des Westens etwa kann Abschreckung durchaus "friedlich" gemeint sein.
Aber das Glaubwürdigkeitsdilemma drängt auch dann in die Richtung des Einsatzes von Atomwaffen, wenn man es "eigentlich" nicht will. Der Psychiater Robert Jay Lifton, der sich mit der Psychologie der Abschreckung befasst hat, charakterisiert dies zutreffend4:
Theoretisch stellt sich die Abschreckung als ein gespaltener Begriff dar: Die helle Seite heißt Frieden oder wenigstens die Abwehr eines nuklearen Holocaust; die dunkle birgt dagegen Pläne für den Holocaust.
Denn geplant wird natürlich, das Atomwaffenarsenal auch wirklich zu gebrauchen, wenn es denn "nötig" zu sein scheint.
Handlungszwänge, die das "offizielle" verkündete Ziel, den Frieden zu fördern, faktisch unterlaufen, spielen natürlich im Kriegsfall eine besondere Rolle. Während alle Beteiligten einander durch den Einsatz von Nuklearwaffen verschiedener Kategorien zum Aufgeben und dadurch zum Frieden zwingen wollen, befürchten Experten, dass es zu einer fast schon automatische Eskalation bis zum interkontinentalen Schlagabtausch kommen könnte.
Das aber wäre dann das Ende der Menschheit. Ein Mitglied des US-Generalstabs sagte einmal: "Niemand weiß, was bei einem Atomkrieg wirklich geschähe. Wir alle haben keine Ahnung."5 Das trifft es.
Politik am Abgrund
Mit dem Glaubwürdigkeitsproblem ist verbunden, was man Brinkmanship nennt, eine Politik am Abgrund. Einer der wichtigen US-Atomstrategen aus der Anfangsphase des Kalten Kriegs, Thomas Schelling, hat sich dazu geäußert. Wir müssen die Analysen der älteren Abschreckungsspezialisten wieder ernst nehmen, wenn erneut auf Abschreckung gesetzt werden soll. Schelling wählte einen Vergleich6:
Nehmen wir an, die konfligierenden Parteien befänden sich in einem Boot. Sagt die eine, sie werde das Boot umkippen, falls die andere nicht rudere – wobei beide untergingen – , so ist es wahrscheinlich, dass ihr die andere Seite nicht glaubt.
Falls jedoch die eine das Boot ins Schwanken bringt, so dass es eventuell tatsächlich umkippen könnte, wird der Partner beeindruckt sein. Einfach zu sagen, man werde das Boot umkippen, ist wenig überzeugend; man muss schon das Boot in Gefahr bringen, um seinen Willen durchzusetzen.
Im Grunde geschieht genau das zurzeit. Es entspricht einer Politik am Abgrund, wenn gegenwärtig beide Parteien (Russland und der Westen) immer weiter eskalieren. Sie sind also dabei, das Boot ins Schwanken zu bringen. Denn niemand weiß, ob und wann der Gegner die atomare Schwelle überschreiten wird.
Aus der Sicht Russlands ist es keineswegs gesichert, dass die Nato ihrerseits nicht zuschlagen wird. Auf den möglichen Ersteinsatz von Atomwaffen hat die Nato, etwa im Unterschied zu China, ausdrücklich nie verzichtet. Russland und der Westen befinden sich in einem Wettstreit im Risikoverhalten, wie Brinkmanship auch genannt wurde.
Natürlich können wir sagen: Was geht es uns an, wie Russland die Lage einschätzt. Aber das ist eine sehr gefährliche Einstellung. Denn nukleare Abschreckung ist ein "Spiel", bei dem im Ernstfall alle Akteure gleichermaßen verlieren.
Objektiv ist es daher von höchstem Interesse, wie Russland die Angelegenheit sieht. Dümmlich ist es daher, solche Bemühungen als "Putinversteherei" zu diffamieren. Kein Stratege könnte es sich leisten zu sagen: Ich ziehe in den Kampf, aber es interessiert mich nicht im mindesten, an welche Taktiken und Operationen der Feind denkt.
Summa summarum kann gesagt werden: Abschreckung ist eine Vorgehensweise, die durch einen hohen Grad an Ungewissheiten geprägt ist. Es handelt sich um eines der fragwürdigsten Verteidigungskonzepte. Innerhalb de SPD gehörte das mal zum Allgemeinwissen. Aber die Grünen waren auch einmal eine Friedenspartei, die sich nicht nur so nannte.
Und das ist eben das große Problem: Alles, was einmal während des Kalten Kriegs zu diesem Thema erarbeitet wurde, ist im Orkus des Vergessens verschwunden. Als Analphabeten befinden wir uns in der Wiederholungsschleife. Erneut wird zum Tanz aufgefordert, aber niemand weiß mehr, wie dieser Tanz auszuführen ist. Man stolpert einfach einmal los.
Dabei darf niemandem, der über Atomwaffen verfügt, ein gravierender Fehler unterlaufen. "Sleepy Joe", wie Biden gelegentlich tituliert wird, oder ein durchgeknallter Narzisst wie Trump sind in diesem Spiel ebenso fehl am Platz wie ein machtbesoffener russischer Diktator. Aber es sind genau diese Leute, die das Leben der Menschheit in der Hand haben, denn sie vor allem treffen die Entscheidung, ob es losgeht oder nicht.
Der Mathematiker und Philosoph Bertrand Russell brachte es einmal auf den Punkt7:
Was die nukleare Konfrontation angeht, kann man unter Umständen annehmen, dass zwei Seiltänzer zehn Minuten balancieren können, ohne abzustürzen. Aber nicht zweihundert Jahre.
Auch nicht unpassend ist das bekannte Zitat des Journalisten Leon Wieseltier8: Nukleare Abschreckung ist "wahrscheinlich das einzige politische Konzept, das total versagt, wenn es nur zu 99,9 Prozent erfolgreich ist."