Wie urdemokratisch ist die Urabstimmung der SPD?
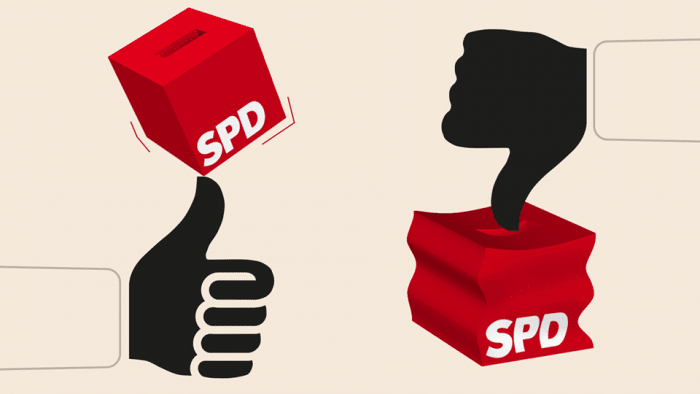
Populistischer Machtmissbrauch ist keine direkte Demokratie
Der SPD ist es tatsächlich gelungen, den Leuten einzureden, dass sie "mehr Demokratie wagen" praktiziert, wenn sie ihre Mitglieder über den Koalitionsvertrag mit CDU und CSU abstimmen lässt. Doch in Wahrheit stellt das nur einen populistischen Missbrauch der schlimmsten Sorte dar. Bei dem allerdings mehren sich die Zeichen, dass die Genossen an der Basis den Spuk wohl nicht mehr lange mitmachen werden.
Tatsächlich stimmt ja mit der "Basis" ein absolut nicht repräsentativer Kreis von sehr besonderen Parteigenossen über etwas ab, worüber zu entscheiden die Wähler vom 24. September 2017 viel berufener sind. Die entschieden wenigstens in einer ordentlichen Wahl. Die SPD-Mitglieder sind nur ein mehr oder minder willkürlich zusammengewürfelter Haufen ohne Mandat.
Die entscheidende Frage lautet: Wer befindet da in dieser "Urabstimmung der SPD" über den Koalitionsvertrag? In den Köpfen der Menschen sind ja die Mitglieder der politischen Parteien so etwas wie ein Mikrokosmos der Gesamtbevölkerung oder auch der Gesamtwählerschaft der SPD. Doch das ist nun einmal einfach falsch. Die repräsentieren nur sich selbst und niemanden sonst.
Über die Mitglieder der politischen Parteien sind aus einer Vielzahl von Studien recht verlässliche Angaben möglich. Sicher ist: In ihrer sozialen Struktur unterscheiden sich alle politischen Parteien drastisch von der wahlberechtigten Bevölkerung.
Die allgemeine Bevölkerung spiegelt sich in den Mitgliedern der SPD extrem verzerrt. Nur 32 Prozent der Mitglieder sind Frauen. Die überwältigende Mehrzahl sind zu 68 Prozent Männer. Der Frauenanteil in der Mitgliedschaft ist eher auf dem Niveau des frühen 20., wenn nicht gar des 19. Jahrhunderts, aber längst nicht auf der Höhe unserer Zeit.
Allein unter Rentnern
Krass unterrepräsentiert sind jüngere Leute im Alter von 18 bis 30 Jahren: Sie machen gerade mal mickrige 8 Prozent aus - genauso viel wie die 31- bis 40-Jährigen. Zur Gruppe der 41- bis 50-Jährigen zählen 11 Prozent. Beherrschend hingegen sind die Leute im Alter von 51 bis über 80 Jahren: Sie machen 73 Prozent aller Parteimitglieder aus. Das sind fast drei Viertel aller Mitglieder. Wer einen Ortsverein irgendwo zwischen Flensburg und Konstanz besucht, den beschleicht leicht das Gefühl, er sei in einem Altersheim unter lauter Bier trinkenden Rentnern gelandet.
Nach der Berufsstruktur ihrer Mitglieder haben sich die Parteien im Laufe der Jahrzehnte zunehmend aneinander angeglichen: Die SPD ist keine Arbeiterpartei mehr, die CDU/CSU keine Partei von Unternehmern und Landwirten und die FDP nicht mehr die Partei des alten und auch nicht des neuen Mittelstands.
Im Laufe der Jahrzehnte seit den 1950er Jahren haben sich die politischen Parteien radikal verändert. Beherrschte davor noch der Gegensatz zwischen Arbeiterparteien und bürgerlichen Parteien die politische Landschaft, so haben sich alle Parteien seither in der Struktur ihrer Mitglieder stark angeglichen: Sie sind ein Spiegel der "nivellierten Mittelstandsgesellschaft" (Helmut Schelsky) geworden und haben sich von ihren traditionellen sozialen Milieus losgelöst. Unter den Mitgliedern aller Parteien dominieren nun Beamte, öffentliche Angestellte und Rentner.
Besonders Angehörige des öffentlichen Dienstes sind in allen Parteien so stark überrepräsentiert, dass Beobachter seit langem "eine personale Verschränkung zwischen Mitgliederorganisation der Parteien und der Staatsverwaltung" konstatieren. Unter der Dominanz von Staatsbediensteten und Rentnern verschwindet fast das Gewicht von Arbeitern und Angestellten aus der privaten Wirtschaft: In der Bevölkerung machen sie zwar 34 Prozent aus, in den Parteien jedoch nur 20 Prozent. Allein 42 Prozent der SPD-Mitglieder sind entweder Beamte oder Angestellte des öffentlichen Dienstes.
Für die Beamten und Angehörigen des öffentlichen Dienstes ist die Parteimitgliedschaft in der SPD ein Karrieretrittbrett. Während früher ideologische Überlegungen die Entscheidung zum Parteieintritt bestimmten, sind das heute eher opportunistische Überlegungen. Der Wechsel vom öffentlichen Dienst in ein politisches Amt verläuft geradezu reibungslos.
Heute prägen Karrieristen die Szene in allen politischen Parteien. Wer in eine Partei eintritt, überlegt, welchen Nutzen das für ihn hat. Wer beruflich auf der Stelle tritt und durch Leistung nicht weiterkommt, kann es auch ohne fachliche Qualifikation mit Hilfe einer Partei noch einigermaßen weit bringen und ein gut bezahltes Amt bekommen. Die Führungskräfte der Parteien sind auf jeden Fall keine Positivauslese. Am Ende der Ochsentour durch die Parteihierarchie stehen lauter Rindviecher …
Allen politischen Parteien fehlt der Nachwuchs. Und der, der noch da ist, wendet sich frustriert ab. Die goldene Zeit der Mitgliederparteien ist vorbei. Das betrifft vor allem die SPD. So konnte die CDU 2008 zwar stolz verkünden, dass sie erstmals mehr Mitglieder hat als die SPD, die sich mehr als hundert Jahre stolz als die klassische Mitgliederpartei rühmte. Doch auch das war nur vordergründig ein Erfolg. Er täuscht darüber hinweg, dass die beiden großen Parteien kaum noch halb so viele Menschen binden wie noch 30 Jahre zuvor.
Die Zahl sinkt weiter und wird weiter sinken. Es ist ein säkularer Trend, der sich auf die eine oder andere Weise in allen entwickelten repräsentativen Demokratien abspielt. Die politischen Parteien waren ein Phänomen des ideologischen Zeitalters, in dem weltanschauliche Organisationen einander gegenüberstanden und um Anhänger wetteiferten.
Der Rückzug der Bürger aus den politischen Parteien ist ein Ausdruck der wachsenden Entfremdung zwischen der Bevölkerung und ihren politischen Repräsentanten. Die CDU hatte schließlich nicht deshalb mehr Mitglieder als die SPD, weil sie so attraktiv geworden war. Der höhere Mitgliederstand ergab sich aus der in der SPD grassierenden Schwindsucht. Auf ihrer rasanten Talfahrt jagte die SPD an der traditionell mitgliederschwachen CDU vorüber. Und die CDU rühmte sich nicht etwa der eigenen Attraktivität, sondern der Schwäche der Konkurrenz. Wer in einer Partei wie der SPD etwas werden will, kommt nicht daran vorbei, sich einige Jahre in der Parteiorganisation zu "bewähren", indem er Flugblätter verteilt, Plakate klebt, Informationsstände betreut, Fähnchen schwenkt, Ortsvereine leitet, Sitzungsprotokolle verfasst, Versammlungen besucht, auf Wahlkampfveranstaltungen applaudiert, Werbe-Kugelschreiber verschenkt oder ähnlich albernen Tätigkeiten nachgeht.
Die SPD ist da ziemlich pingelig. Wer sich nicht mit der gebührenden Gründlichkeit mit dem Stallgeruch eines Ortsvereins parfümiert hat, wird so gut wie nie als Kandidat für ein Amt nominiert. Und in den Ortsvereinen der politischen Parteien weht nun einmal nicht der Duft der großen weiten Welt, sondern ein penetrant riechender piefiger Mief.
