Corona und die sozialen Fragen
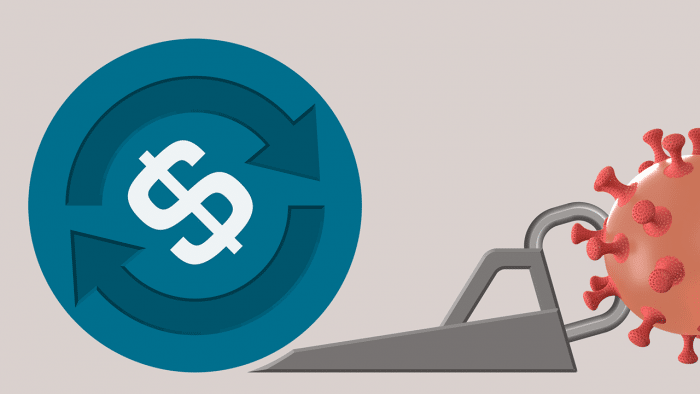
Woran man sich erinnern sollte - Teil 6
Von Hong Kong aus hat sich im April ein Graffito verbreitet: "There can be no return to normal because normal was the problem in the first place." Das klingt nicht schlecht, die Frage ist aber, ob den Protagonisten solcher Sprüche eigentlich klar ist, was sie da sagen.
Prekäre Verhältnisse
Eine marxistische Erläuterung des Satzes könnte immerhin so aussehen: "Die Notwendigkeiten des kapitalistischen Normalbetriebs [… zeichnen] dafür verantwortlich, dass ihre schiere Suspendierung so katastrophale Folgen für die Mehrzahl der Beteiligten hat. […] Wenn die Freisetzung von Lohnarbeit, mit der man sich seinen Lebensunterhalt gemeinhin verdient, dem Ruin der eigenen Existenz gleichkommt, dann steht vom [Lohn …] eines schon mal fest: Als Mittel zur Sicherung der eigenen Existenz taugt er offenbar nicht." Würden die Betroffenen dies als eine praktisch erfahrene Wahrheit ihrer Lebensumstände festhalten, könnten sie einen gewissen Widerspruch zu ihrem Appell an ‚Vater Staat‘ bemerken, möglichst schnell die alten Zustände wiederherzustellen, in denen die aktuelle Notlage doch ihren Ursprung hat.
Leider führt sie ihre Betroffenheit in der Regel in die falsche Richtung. Nicht in den normalen marktwirtschaftlichen Lebensumständen, in denen sie sich auch schlechten Erfahrungen zum Trotz im Prinzip aufgehoben fühlen, sondern in einer exzeptionellen Virus-Epidemie und in den gesundheits- und ordnungspolitischen Gegenmaßnahmen sehen sie den Grund der Misere - und suchen nach Schuldigen.
Eine Mehrheit von Bürgern wirft dem Staat mangelnde Verantwortung für ihre persönliche und die Volksgesundheit vor - und verpasst darüber die berechnende Abwägung, die er zu Beginn der Pandemie zwischen einem ungestörten Geschäftsverlauf und den notwendigen, ihn unterbrechenden Schutzmaßnahmen getroffen hat. Mit dem geschäftsschädigenden Übergang auf Letztere und seinem relativen Erfolg entdeckt die Kritik aus Betroffenheit dann umgekehrt, dass der Staat es wohl übertrieben und unnötige Schäden verursacht habe.
Das veranlasst eine bürgerliche Minderheit zu dem Fehlschluss, im Regierungshandeln nicht länger die Vertretung ihrer bzw. der deutschen, sondern die von fremden Interessen zu sehen: die des internationalen Kapitals, der globalisierten Eliten oder die von Mr. und Mrs. Gates. Sie und weitere Kritiker halten den epidemiologisch gebotenen Mundschutz für einen Maulkorb, der sie an der "Aufdeckung" ihrer imaginierten Verschwörungen hindern soll oder die Generalprobe für ein grundloses Kontrollregime darstellt, das im Virus bloß einen Vorwand habe. Lauter ideologische Übersetzungen prekärer Verhältnisse, in denen eine Masse von Einkünften aus abhängiger wie kleingewerblicher Tätigkeit am Monatsende verbraucht und auf lückenlose Fortsetzung gnadenlos angewiesen ist.
Über den Lohn hinaus und auch ohne Corona, also etwa im Normalzustand des Jahres 2018, zeichnen sich z.B. hinsichtlich der Renten, die man sich von einer lebenslangen Arbeit für Entgelt gemeinhin als auskömmlich verspricht, prekäre Verhältnisse ab: "20 Millionen rentenversicherte Arbeitnehmer und Selbstständige verdienten weniger als das Durchschnittsjahresgehalt, [mit dem sie] einen Entgeltpunkt erwerben. Dieser bringt derzeit rund 33 Euro Monatsrente im Westen und knapp 32 Euro im Osten ein. Nach 40 Arbeitsjahren mit Durchschnittsverdienst kommt man aktuell auf eine Brutto-Monatsrente von 1.322 Euro (West) oder 1.276 Euro (Ost)."
Für zwei Drittel der Rentenversicherten erweist sich also ihr Arbeitsleben absehbar als nicht hinreichend, um sich damit eine Durchschnittsrente von 1300 Euro brutto zu ergattern. Was lehrt das über den Lohn als Mittel des Lebens?
"Singapur scheitert"
Neben den unmittelbar Betroffenen kann natürlich jedermann solche sozialen Fragen stellen. Journalisten zum Beispiel tun das - meist aber gleich als die bekannte Schuldfrage, die sie gerne und dann ungeniert auch an fremde Staaten richten. Die Tagesschau deutet dieserart auf eine soziale Lage, an der angeblich "Singapurs Corona-Kurs scheitert": "Singapurs Wohlstand beruht auch auf den niedrigen Löhnen Zehntausender Wanderarbeiter." "Singapur galt als Vorbild bei der Bekämpfung der Infektion. Dann explodierten die Zahlen regelrecht." Denn "besonders heftig wütet das Virus in den Wohnheimen der Niedriglohnarbeiter", wo sie "dicht gedrängt und abgeschottet" wohnen. Das erforderte einen allgemeinen Lockdown, der vorher nicht nötig erschien.
"Singapur", so der ARD-Korrespondent Ende April - also zeitgleich zur Meldung von Corona-Ausbrüchen in deutschen Wohnheimen von rumänischen Schlachtern und Erntehelfern sowie in Flüchtlingsunterkünften - "ist mit Deutschland natürlich nicht vergleichbar, kann aber nichtsdestotrotz als Warnung dienen." Dass "Berlins Corona-Kurs scheitert" wie der im demokratisch stets beargwöhnten Singapur, ist dem Korrespondenten nicht eingefallen, vielmehr dass beide Vorgänge "natürlich nicht vergleichbar" sind.
Singapur greift nämlich auf südasiatische Billiglöhner zu, während Deutschland osteuropäische bevorzugt. Außerdem erntet man in Singapur keinen Spargel. Auch die staatlich angeordneten Eindämmungsmaßnahmen lassen sich nicht vergleichen. Denn die einen betreffen Einzel-Kubikel in umgerüsteten Messehallen, die anderen beruhen auf Einzelunterbringung in Hotels und Heimen. Warum Erstere "scheitern" sollen, steht dahin. So jedenfalls geht Journalismus mit Blick durch die schwarz-rot-goldene Brille.
"Fremdarbeiter"
"Wegen Corona" erfährt die Öffentlichkeit einmal mehr von den schäbigen Arbeits- und Lebensbedingungen der knapp 50.000 "Fremdarbeiter" in den deutschen Fleischfabriken. Zum Ausgleich kommen auch die Nöte ihrer Arbeitgeber zur Sprache, deren Wortführer betonen, Betriebe würden Pleite gehen oder nach Osteuropa abwandern, wenn sie ihre Akkord-Schlachter im Werkvertrag besser bezahlen und in Einzelzimmern unterbringen müssten.
Das ist doch auch eine beispielhafte Auskunft darüber, wie sich ein lohnendes Geschäft mit Nahrungsmitteln und der Lohn derer, die sie produzieren, als Lebensmittel ausschließen. Wenn die deutschen Dumpinglöhne entsprechende Jobs in Belgien, Frankreich, Holland und Dänemark überflüssig gemacht bzw. in die BRD geholt haben (tagesschau 3.6.20), so zeigt dies außerdem, dass für die Erfolge des Standorts Deutschland nicht nur die Hightech des Auto- und Maschinenbaus erfordert ist, sondern auch Methoden des "Manchesterkapitalismus" noch ganz brauchbar sind.
Die jährlich 300.000 osteuropäischen Saisonarbeitskräfte in der Landwirtschaft geraten ebenfalls in die Berichte der Medien, weil sie wegen der Pandemie-Bekämpfung nicht in erforderlicher Menge einreisen können: "Geprüft werde nun, wie der Ausfall durch Arbeitskraftpotenziale in Deutschland kompensiert werden könne, möglicherweise durch Asylbewerber oder durch Arbeitnehmer in Kurzarbeit" - am besten also durch Leute, deren Existenzsorgen die nötige Bereitschaft hervorbringen, sich harte Arbeit durch miesen Lohn entgelten zu lassen. Etwa derart, wie es der deutsche Agrarsektor von seinen Rumänen und Bulgaren schon lange gewohnt ist, die so zu dessen Erfolg als drittgrößtem Exporteur weltweit beitragen durften.
"Polinnen"
Auch eine weitere, noch größere Arbeiterarmee aus Osteuropa, prominent Polen, ist längst als fester Posten ins deutsche Sozialsystem und seine Kostenreduzierung eingeplant und eingepreist. Das "Wohlstandsgefälle" in der EU sorgt normalerweise, von Corona also abgesehen, auch hier für den nötigen Nachschub billiger Arbeitskräfte. Die tragen sogar dazu bei, dass die Löhne ihrer deutschen KollegInnen in der Alten- und Krankenpflege für die öffentlichen und privaten Arbeitgeber ebenfalls finanziell überschaubar bleiben.
Mehr als die Hälfte dieser "Care Workers" arbeitet überdies in Privathaushalten - und die zuständigen Behörden drücken in Sachen Arbeitsvertrag oder Sozialversicherung und auch bezüglich der ihnen entgehenden Lohnsteuer durchaus ein Auge zu, weil sie die kostensenkende Wirkung dieser ungeregelten Arbeitsverhältnisse sozialstaatlich schätzen.
Vergleichsmaßstab 1
Ob am Stammtisch oder in der Redaktion - Verteidiger solcher Zustände bemühen oft ein Argument, demgemäß sich Osteuropäer als die Niedriglöhner der EU noch glücklich schätzen könnten, sogar in Zeiten von Corona, wenn sie sich mit den Bewohnern anderer Weltgegenden vergleichen.
Laut Tagesschau (Stand 9.4.20) gibt es in Mali/Westafrika ganze vier Beatmungsgeräte. Vielleicht bringt die Bundeswehr ja noch ein paar mit. Staaten dieses Typs sind also trotz und wegen ihrer jahrzehntelangen Einbindung in den Weltmarkt offenbar nicht in der Lage, sich irgendwelche Pandemie-Maßnahmen zu leisten, die über das Verscheuchen von hungerndem Volk hinausgehen. In den schwarzen Armenvierteln Südafrikas passiert Vergleichbares. Auch die Völkerschaften von Staaten, die es in der Globalisierung etwas weiter gebracht haben, deren Frauen z.B. wie in Bangladesch/Südasien die westliche Billigmode zusammennähen, geraten in Existenznot, wenn die Frühjahrskollektion in Europa virusbedingt ausfällt.
Die Flüchtlinge aus Syrien an den Ostgrenzen der EU schließlich, von denen Deutschland 2015 noch außenpolitischen Gebrauch machen konnte, um sich Mitsprache bei der "Konfliktlösung" zu verschaffen, sind aktuell zu einem zwischenstaatlichen Störfall geworden, der den Wert ihres Überlebens stark gemindert hat.
Vergleichsmaßstab 2
Auch die Beschäftigten und Arbeitslosen mit deutschem Pass sollen sich, der Politik und ihrer Öffentlichkeit zufolge, in der Corona-Krise vergleichsweise gut bedient sehen, weil ihre Kollegen in Italien oder Spanien viel schlechter dastünden. Nicht zu reden von den USA, deren Gesundheitswesen mit der Übersterblichkeit von "People of Color" einhergeht und deren Sozialstaat es derzeit mit 40 Mio. Bürgern ohne Lohn und bei einem Gutteil davon schon ohne Brot zu tun hat.
Auch die südeuropäischen Entlassungswellen sind größer als die deutschen, die staatlichen Zuwendungen geringer, die Waffen der Verschuldung, welche die Regierungen auch dort auf den Tisch legen, sind lange nicht so scharf wie die der Bundesrepublik. Das liegt erstens an der Exportmeisterschaft z.B. der deutschen Autobauer, zu der die festangestellten und ausgeliehenen sowie durchrationalisierten Belegschaften ihren Teil beisteuern durften. Zweitens geht das auf die deutsche Dominanz an den Kapitalmärkten zurück, wo sich die BRD mit Zinsgewinn und nach oben offen verschulden kann, während andere um ihre Verschuldungsfähigkeit zu ringen haben und dafür auf die deutschen Vorgaben angewiesen sind.
Deshalb klagen Staaten wie Italien oder auch Frankreich darüber, dass Deutschland in der Lage ist, allein so viel Wirtschaftshilfe zu mobilisieren wie der Rest der EU zusammen, und so z.B. die Lufthansa zum Nachteil anderer Fluglinien retten kann. Solche EU-Mitglieder beschweren sich auch über die vergleichsweise hohen Ausgaben für Kurzarbeitergeld in der BRD, weil sie fürchten, dass der Erhalt von Belegschaften im Wartestand beim marktwirtschaftlichen Neustart die deutsche Vormachtstellung in der europäischen Konkurrenz noch vergrößern wird.
Das heizt auch den jeweiligen Nationalismus an, und so erfahren z.B. französische Zeitungsleser, dass sie via EU-Haushalt angeblich die deutschen Kurzarbeiter mitbezahlen, während den Bild-Lesern ausgemalt wird, wie sehr ihnen die französischen Frührentner auf der Tasche liegen usw.
"Kein Freibier"
Die wirklichen Gründe für eine Zunahme der Misere, welche die abhängig Beschäftigten und andere "einfache Leute" vom Fortgang der Corona-Krise eventuell zu erwarten haben, finden sich in den ökonomischen und politischen Maßnahmen, mit denen Kapital und Staat dieselbe europaweit zu bewältigen suchen. Auszüge aus dem entsprechenden "Diskurs": Die Industrie fordert parallel zur Bekanntgabe ihrer Entlassungspläne - und ihrer Bereitschaft, auch an einer klimarettenden Energiewende verdienen zu wollen -, den "Lasten-Abbau im Energie-, Wettbewerbs- und Umweltrecht". Aus der Regierungspartei, die bei den Wählerumfragen in der Krise am meisten profitiert, kommt der Vorschlag, den Mindestlohn wieder abzusenken. Der Chef der Wirtschaftsweisen verbietet "Freibier für alle" und erklärt einen Corona-Bonus für Familien zu "rausgeschmissenem Geld".
Ein Kanzler-Kandidat der CDU will "nach der akuten Krise alle staatlichen Leistungen von Bund, Ländern und Gemeinden auf den Prüfstand stellen" und zwar "Subventionen ebenso wie soziale Transferleistungen". Und Bayerns Söder plädiert für einen Schuldendeckel bei 100 Mrd. Euro. Der wächst dann im aktuellen Konjunkturpaket von Anfang Juni auf 130 Mrd. an, gewährt Überbrückungshilfen und zielt mit Investitionen in die sog. Zukunftstechnologien unmittelbar auf die Wiederbelebung der Geschäfte. Eine temporäre MwSt.-Senkung, ein Kinderbonus, stabilisierte Strompreise und Sozialabgaben sowie Kaufprämien für E-Autos sind eingeschlossen, damit die wachstumsfördernde Stärkung der Massenkaufkraft ebenfalls Umsätze und Gewinne ankurbelt.
Die FAZ bringt es ganz gut auf den Punkt: "Sollten Unternehmen die [MwSt.-] Entlastung selbst einstreichen, statt den Preis ihrer Produkte zu ermäßigen, ist das zwar ein Mitnahmeeffekt, der aber Wirtschaft und Arbeit in einer schwierigen Zeit ebenfalls stützt." Wirtschaftshilfen sind eben "kein Freibier", sondern stattliche Interventionen zu dem Zweck, dass die Rechnungsweise dieser Gesellschaft mit rentablen Arbeitskräften, die vernutzt, und kostengünstigen Umweltbedingungen, die geschädigt werden, in Kraft bleibt.
"Schuldentragfähigkeit"
Aus dieser marktwirtschaftlichen Räson, die der bürgerliche Staat lizensiert und verwaltet, erklärt sich auch der Umstand, den kritische Stimmen fälschlicherweise als staatliche Inkonsequenz, Kleinlichkeit oder gar Komplizenschaft mit dem Real- und Finanzkapital der Milliardäre beklagen. Für diese Klientel des Staats sei nämlich keine Schulden-"Bazooka" zu groß, während bereits jetzt schon z.B. die vereinbarte Grundrente von Teilen der politisch Zuständigen als zu hoch oder als verschiebenswert betrachtet würde.
Selbst der gestrige "Schwarze-Null"- und heutige "Wumm"-Minister Scholz schärft das sozialdemokratische Profil gerade mit diesem Vergleich: Wer Milliardenkredite vergebe, aber bei den Renten knausere, "gehört eigentlich ausgebuht" (tagesschau online 2.6.20). Unzufriedenheit der "einfachen Leute" mit dem Konjunkturpaket, später vielleicht mit krisenbedingten Sparmaßnahmen dürfte diese Kritik und die Forderung weiter anheizen, auch die Superreichen müssten für die Krise zahlen.
Dabei ist die staatliche Haushälterei nur konsequent und systemlogisch. Ihr geht es nämlich um die sog. "Schuldentragfähigkeit" des deutschen Standorts, der seinem Verwalter die finanzielle Hoheit und Freiheit gewährleistet, sich nach Lage und Ermessen am Finanzmarkt zu bedienen und alle staatlich ermittelten und anerkannten Geldbedarfe - whatever it takes - zu decken. Wie schon der Gesundheitsminister so will auch der Finanzminister hier keine "italienischen Verhältnisse" einreißen lassen. Deshalb ist das Sparen an den "Sozialtransfers" nicht kleinlich, sondern nötig, um eine Haushaltsführung wieder "solide" erscheinen zu lassen, also dafür zu sorgen, dass von ihr die richtigen Signale an die Finanzwelt ausgehen.
Um ein "Tripple-A"-Land zu bleiben, dessen Bonität die privaten und institutionellen Anleger so schätzen, dass sie dem Schuldner sogar Zinsen zahlen, müssen auch die Mindestlöhner, die Respekt-Rentner, das Kleingewerbe und die abhängig bzw. Nicht-Beschäftigten überhaupt ihren Beitrag leisten. Die Real- und Finanzkapitalisten werden schon auch zur Kasse gebeten, z.B. mit höheren Zinsen für die Überbrückungs-Darlehen. Dabei sieht sich die Regierung jedoch zur Rücksicht darauf veranlasst, dass dieser Klasse für ihre Dienste, von denen Staat und Gesellschaft leben, auch genügend monetäre Eigenmittel und Zugang zu Bank-Krediten verbleiben. So gesehen sind auch Dividenden-Ausschüttungen oder Derivatehändler weiterhin "systemrelevant".
Gewerkschaftsarbeit
Wie sehr die Arbeitseinkommen in Deutschland und weltweit unter Krisendruck geraten, wird man sehen. Der marktwirtschaftlichen Logik nach ist zu erwarten, dass die Arbeitgeber ihre verringerten Umsätze und Gewinne kostenbewusst in einer Kombination aus Lohnsenkung, Entlassungen und Änderung der Arbeitsbedingungen zu ihren Gunsten an ihre Arbeitnehmer weiterreichen.
Vom "Angebot" an Beschäftigte, sogar von deren Bereitschaft, auf Lohn zu verzichten, um den Arbeitsplatz zu sichern, hört man nicht nur bei Lufthansa. Ob seitens der Geschäftswelt noch Preissteigerungen für Lebensmittel, Mieten u.ä. dazukommen, ist derzeit nicht klar absehbar. Erhöhte Steuern und Abgaben bzw. reduzierte Sozialleistungen sind aktuell nicht im deutschen Konjunkturpaket, zu einem späteren Zeitpunkt aber nicht auszuschließen. In der Bewältigung der Finanzkrise von 2008 waren solche Vorgänge jedenfalls zu beobachten - und nicht nur in Griechenland.
Zur Abwehr des Drucks auf die Löhne und seine eventuelle Verstärkung durch höhere Preise und Abgaben haben die abhängig Beschäftigten im Grunde nur ein wirksames Mittel zur Hand. Einen Mindestlohn mag ihnen "Vater Staat" sichern. Die Abwärtsbewegung der Löhne mittels verschärfter Konkurrenzbedingungen hat er zwar unter dem Titel Hartz IV selbst befördert, will sie deswegen aber zugleich auf niedrigem, wirtschaftsverträglichem Niveau stabilisieren.
Wenn es mehr sein soll, müssen die Lohnabhängigen schon von einem Recht Gebrauch machen, das ihnen der bürgerliche Staat nach langen Auseinandersetzungen in Hinsicht darauf eingeräumt hat, dass auch die Interessen der proletarischen Wirtschaftsbürger im Prinzip anerkannt sind und vertreten werden dürfen. Gewerkschaften sind zugelassen und in der Lage, die nachteilige Konkurrenz der Beschäftigten um den Lohn vorübergehend auszusetzen, Senkungen abzuwehren, Erhöhungen und verbesserte Arbeitsbedingungen zu erzielen.
Da dies dem unternehmerischen Interesse widerspricht, erreichen Gewerkschaften die Besserstellung der Arbeitnehmer in der Regel durch angedrohten oder vollzogenen Arbeitskampf, für dessen Zulässigkeit der Staat rechtliche Grenzen gezogen hat. Nur im Ausnahmefall kann die Konkurrenz der Arbeitgeber um ein knappes Angebot an Arbeitsvermögen den Lohnbeziehern gewissermaßen zum Vorteil gereichen. Osteuropäischen Erntehelfern, so liest man, kommen derzeit noch die Reisebeschränkungen sowie eine außerdeutsche Nachfrage zu pass, was ihre Bezahlung manchmal über den Mindestlohn hebt. Auch kann die Konkurrenz der Arbeitgeber seltsame Blüten treiben: "Weil der Mindestlohn [in Deutschland] niedriger ist als auf der anderen Rheinseite", überfluten "die deutschen Landwirte den Markt dort mit billigem Spargel [und] die französischen Arbeitgeber verlangen von den deutschen Gewerkschaften, dass sie für höhere Löhne in der Landwirtschaft sorgen sollen".
Unter dem Gesichtspunkt der Nachfrage nach Fach- und Arbeitskräften hätte die Gewerkschaft ver.di Anfang März beim Charité Facility Management in Berlin vielleicht keine schlechten Karten gehabt, um einheitliche und verbesserte Tarife für ein Personal durchzusetzen, dessen "Systemrelevanz" heute in hohen Tönen gelobt wird und ihm wohl auch eine schulterklopfende Einmalzahlung einträgt. Der Bundesvorstand drängte allerdings auf die Absage des Arbeitskampfs in Corona-Zeiten. Die Tarifkampagne im öffentlichen Nahverkehr wurde ebenfalls ausgesetzt, dessen Beschäftigte auch zu den "Helden des Alltags" zählen. Ver.di hielt "die Uhr an, denn […] die Pandemie stellt uns vor große Herausforderungen, die Auswirkungen auf Unternehmen und Gesellschaft sind aktuell nicht absehbar".
Eine gesundheitsbezogene Vernunft ist diesem "Burgfrieden" nicht abzusprechen, und man wird sehen, was aus den gewerkschaftlichen Ankündigungen für die Tage nach dem Ablauf dieses Friedens folgen wird. Zu optimistisch sollte man hier aber nicht sein, denn die Gewerkschaften sind davon überzeugt, dass eine Krise keine guten Bedingungen für Verbesserungen durch Arbeitskämpfe bietet. Der Boom allerdings auch nicht so richtig, weil er nicht durch überzogene Ansprüche gefährdet werden dürfe. Zwar wachsen in Krisenzeiten die materiellen Gründe für eine Gegenwehr an, zugleich gewinnen die Unternehmer aber an Druckmitteln.
Was dem gewerkschaftlichen Denken immer einleuchtet, ist der Verweis auf den geschäftlichen Erfolg derer, die Arbeit geben, weil sie dies ohne ihn leider nicht mehr tun könnten. Kein Wunder, dass moderne Gewerkschaften zusammen mit ihrer Klientel den Ausweg aus dieser verspürten Klemme beim politischen Sachwalter der marktverfassten Gesellschaft suchen:
Der DGB pocht in der Corona-Krise auf staatliche Anreize zur Förderung des Autokaufs. [Ein] Vorstandsmitglied sagte […], eine Kaufprämie für Fahrzeuge sei sinnvoll [… und] forderte weiter, die Bundesregierung müsse schnellstens ein Konjunkturprogramm auflegen und damit den Konsum ankurbeln. Außerdem drängte der Gewerkschafter auf mehr Personal im öffentlichen Dienst.
Neue Osnabrücker Zeitung
Im gewerkschaftlichen Selbstverständnis wäre das - ihren offenkundigen Gegensätzen zum Trotz - eine Art Win-win-Situation für beide ökonomischen Klassen. Solche Vorschläge bieten der Regierung wie der Opposition die Gelegenheit, sich durch eine verantwortungsbewusste, aber kontroverse Diskussion über die "Mach- und Finanzierbarkeit" der Forderungen für die nächste Wahl zu empfehlen. So oder ähnlich hält der DGB sich und die von ihm vertretenen Interessen öffentlich im Spiel und zeigt Relevanz.
Ein Bündnis mit Fridays for Future, soweit den einzelnen Gewerkschaften an ihm liegt, muss allerdings auf etwas anderem Weg angebahnt werden, versuchsweise durch die Forderung nach klimaschonenden Zukunftstechnologien, die neue Arbeitsplätze und "unsere" Wirtschaft nach vorn bringen. Die Partei der Linken bemüht sich, in ihren Ruf nach Konjunkturmaßnahmen den Aspekt des "Infrastruktursozialismus" einzubringen. Wie der britische Trades Union Congress, so begrüßen auch sie: "The state is back!" Also der, der die Grundlagen dafür gesichert hat und sichert, die aus einer Virus-Epidemie eine Krise der Einkommen und Lebensverhältnisse machen.
Bedingungsloses Grundeinkommen
Es ist absehbar, dass die Rückkehr zur Normalität - nach der Seite der Krisenabwicklung hin wie bezüglich der ins Auge gefassten Produktionsfortschritte - Personalkosten einsparen und ökonomisieren, also tendenziell überflüssige Arbeitsbevölkerung schaffen wird. Dies ist übrigens auch der dem Kapital immanente Weg, eine eventuelle Knappheit von Arbeitsvermögen (s.o.) zu überwinden.
Eine substanzielle Arbeitszeitverkürzung könnte dem entgegenwirken, müsste aber, will man sie nicht bloß von Arbeitszeitmodellen der Unternehmen in deren Interesse abhängig machen, sozusagen erkämpft werden. Und hier treffen Gewerkschaften, wie beschrieben, wieder auf die verspürte Zwickmühle.
Obwohl die Arbeitgeber die Entlassungen zwar betreiben, um ihre Gewinne zu sichern und zu erweitern, schadet ihnen der Personalabbau zugleich insofern, als er die gesellschaftliche Kaufkraft mindert, die zur Verwandlung der innovativen Produkte in Geld nötig ist. Angesichts dieses Widerspruchs erklärt sich das kleine Rätsel, dass auch vorausdenkende Vertreter des Kapitals dem Vorschlag beitreten, Einkommen und Leistung bzw. Arbeiten und Essen zu entkoppeln und die chronisch Arbeitslosen wie die Beschäftigten mit einem bedingungslosen Grundeinkommen (BGE) auszustatten. In der Diskussion sind Beträge von monatlich 600 bis 1000 Euro.
Siemens-Chef Kaeser hat sich vor gut drei Jahren (SZ, 20.11.16) wie zuvor schon sein Kollege Höttges von der Telekom (Zeit, 29.12.15) dieser Forderung angenähert, die eher im politisch linken Lager beheimatet war und ist, von den Gewerkschaften aber - noch - als unsozial, nicht finanzierbar und als Aushebelung ihrer Mitsprache abgelehnt wird. Es wäre doch nicht schlecht, so müssen sich die beiden Chefs gedacht haben, wenn die fiskalische Stützung der allgemeinen Kaufkraft dem Zweck der Rationalisierungsmaßnahmen, nämlich bleibende und erhöhte Umsätze, entgegenkäme.
Hier könnten sogar die Arbeitnehmer als gesellschaftliche Klasse in ihrer Eigenschaft als Steuerzahler die Schäden kompensieren helfen, die ihnen in ihrer Eigenschaft als Lohnempfänger entstehen - ähnlich, wie sie das mit den Zwangsabgaben für die Sozialversicherungen seit Bismarcks Zeiten tun. Auch könnte ein öffentlich finanziertes Basiseinkommen für alle den Unternehmen dazu verhelfen, bei der Lohnzahlung deren Bezug zu den Notwendigkeiten einer proletarischen Lebenshaltung weiter hinter sich lassen und dabei berechnend die Staatsknete einzukalkulieren.
Die Politik allerdings ziert sich derzeit noch gegenüber einem solchen BGE, obwohl sie der damit verbundene Bürokratieabbau bei den diversen "Sozialtransfers" locken könnte. Noch aber möchte sie die gesellschaftliche Lohnsumme weitgehend exklusiv mit den Unkosten belasten, die aus der marktwirtschaftlichen Inanspruchnahme der Arbeitskraft einschließlich ihrer Freisetzung entstehen. Wenn aber das System der Lohnarbeit, von dem die Arbeiter so recht und schlecht leben, nur dadurch am Laufen zu halten ist, dass der Staat als "ideeller Gesamtkapitalist" dazu lauter noch schlechtere Ausnahmen durch öffentliche Zuschüsse organisiert, etabliert sich vielleicht eine moderne Ergänzung der "sozialen Frage", die niemals alt wird.
Teil 1: Journalismus und Corona - Woran man sich erinnern sollte
Teil 2: Marktwirtschaft und Corona
Teil 3 Vater Staat und Corona
Teil 4: Corona und die Rückkehr zur Normalität
Teil 5: Corona und die Verteidigung der Grundrechte
Der Autor war Lehrkraft an verschiedenen Schularten, bevor er 2016 das Berufsleben hinter sich ließ. Seit 2013 schrieb er regelmäßig für das Online-Magazin für Bildung und Erziehung AUSWEGE. Als dieses zum 1.1.2020 sein Erscheinen auf unbestimmte Zeit unterbrach, wechselte er zu Heise/Telepolis. Seine Aufsätze bei AUSWEGE sind weiterhin zugänglich.
